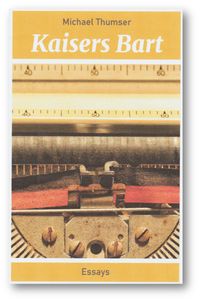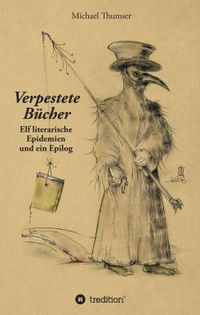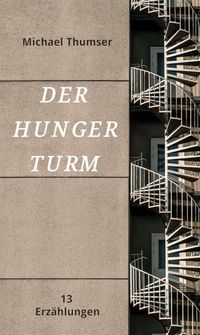24. Februar, Hof, Theater, Großes Haus
Requiem für einen Mörder: Regisseur Kay Neumann und sein achtköpfiges Ensemble fragen im Kriminalstück Tannöd - nach Andrea Maria Schenkels Erfolgsroman von 2006 - nicht so sehr danach, wer der Täter war, sondern umso mehr, wer die sechs Opfer waren. Ausstatterin Monika Frenz verlegt die Szenerie ins Freie, wenn auch nicht an die frische Luft. Ihre Bühne zeigt, dass man in einem Birkenwäldchen nicht zwingend Tschechow spielen muss.
Eckpunkt
27. Februar 2026 Schreibende, die auf sich halten, stehen ihrer Produktion stets mit einem Gran Skepsis gegenüber. Was sie erschaffen, enthält ihr Bestes, drückt ihr Innerstes aus, spiegelt ihr Selbst womöglich bis in Abgründe hinab; das dürfen wir als Lesende erwarten. Zugleich wissen die Autorin und der Autor, dass sie bei allem Eifer nichts zustande bringen, was geeignet wäre, etwa den medizinischen Fortschritt zu beflügeln, die Klima- und andere Krisen einzudämmen, die Gefahren der KI in den Griff zu bekommen … – oder auch nur einem armen Kind ein paar neue Schuhe zu verschaffen. Was Bücher ‚bewirken‘, entzieht sich der Messbarkeit. Menschlich können wir mithin leicht nachvollziehen, dass seriöse Schreibende gelegentlich sich ihrer selbst versichern und, sich Mut zusprechend, auf der Strahlkraft ihrer Arbeiten beharren. Von John Milton ist uns die Überzeugung überliefert, Bücher seien nicht einfach tote Gegenstände, sondern angefüllt mit einer Art Élan vital, einer Lebensdynamik, „so beflissen wie die Seele, deren Kinder sie sind. Wie in einer Phiole bewahren sie die ergiebigste Quintessenz des lebendigen Geistes, der sie erzeugte.“ Oder ists doch eher ein Gegensatz: Buch versus Geist? Schon der Apostel Paulus (im zweiten der neutestamentlichen Briefe an die Korinther) schreibt: „Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ Humanistische Agnostiker erinnern sich wahrscheinlich besser an den Griechen Platon, der in seinem „Phaidros“ dem Gespräch huldigt, denn verglichen mit dem lebensvollen Dialog der Geister, Seelen, Haltungen erscheine alles Aufgeschriebene abgestorben. In den „Holländerinnen“, dem schmalen Meisterroman, für den Dorothee Elmiger im vergangenen Jahr hochverdient den Deutschen Buchpreis gewann, heißt es sinnverwandt und geistverwirrend lapidar, „das Schreiben habe immer etwas mit dem Tod zu tun“. Aber das Lesen mit dem Leben, dürfen wir hinzufügen. Denn ist ein Buch erst einmal fertig geschrieben, an ein Ende, vielleicht gar an ein Ziel gebracht, so liegt es ja nicht als Leichnam vor uns. Sobald ein Autor den letzten Punkt gesetzt hat, verwandelt sich sein Abschied vom Stoff zum springenden Punkt, an dem wir Lesende aufbrechen und Fahrt aufnehmen. Natürlich hat Elmiger mit dem Diktum ihrer traumatisierten Protagonistin recht: In einer astronomischen Vielzahl von Büchern wird gestorben, und in den besseren von ihnen ist der Tod zumindest eines der Themen, wenn nicht das hauptsächliche. Zugleich aber helfen uns die Bücher, mit dem Gedanken an den Tod vertraut zu werden, indem sie uns mit der Einsicht in die Sterblich- und Vergänglichkeit auch eine immer neue Ahnung vom Wert des Lebens vermitteln. Und haben die Ideen von Platon, Paulus oder Milton nicht bis heute überdauert, obwohl die Denker selbst schon vor Äonen verblichen? Was jemand schreibt, verdankt sich ganz oder in Teilen seiner Biografie - seinen sehr persönlichen Eingebungen, Erlebnissen und Erfahrungen - und friert es ein; in Verwesung indes geht das Geschriebene darum nicht über, wirkt doch, im Gegenteil, jeder Leser, jede Leserin daran mit, es zu multipler Auferstehung wieder aufzutauen. Die Lebenszeit des Autors, die, solang er schrieb, verstrich, und die erfundene Vergangenheit des Erzählten verwandeln sich, während wir uns ins Buch vertiefen, in die Gegenwart von uns selbst, und jeder von uns vollendet das Werk durch sein Eigenes mit. ■
Alle bisherigen Kolumnen in den
Eckpunkt-Archiven (siehe oben im Menü)
LRückblick
20. Februar, Sachbuch
Wenn Tonkünstler über ihr Tun sprechen, so munkeln sie gern pathetisch von der Sprache der Seele und dergleichen. Auch der aus Hof stammende Spiegel-Journalist Ullrich Fichtner scheut die Phrase von der Macht der Musik nicht; so betitelte er sogar sein neues Buch. Er aber ergründet wissenschaftlich profund, dabei fesselnd lesbar, wie und warum Musik unwiderstehlich auf Leib und Seele wirkt. Und er fragt, ob es überhaupt unmusikalische Menschen gibt.
17. Februar, Hof, Freiheitshalle, Großes Haus
Der namhafteste Geheimagent der Welt starb 2021 vor aller Augen, auf der Kinoleinwand, den Heldentod. Indes sprüht seit 1962, seit dem ersten „007“-Abenteuer, das main theme der erfolgreichsten Kinoserie aller Zeiten vor Leben als nicht minder berühmte Ikone der Filmmusik. Dem Sound of James Bond erwiesen die Hofer Symphoniker vor über zweitausend stehend applaudierenden Zuhörenden ihre Reverenz: angemessen im Breitwandformat, im Tonfall vollorchestral.
Theater Hof
Schauspiel
zuletzt
Tannöd
Simpel
Verbrennungen
Die Orestie
Musiktheater
zuletzt
Die Geisterbraut
Die Bajadere
Monty Python’s Not the Messiah
Die Tagebücher von Adam und Eva
Theater andernorts
zuletzt
Der große Gatsby in Bayreuth
Prima Facie im Vogtlandtheaster
Die Meistersinger in Bayreuth
Salome im Vogtlandtheater
Konzert
zuletzt
Requiem für einen Geheimagenten: Die großen Hits der „James Bond“-Filme in Hof
„Gitarrenhighlights“: Siegbert Remberger mit Tangos und Beatles-Hits
Faszination Harfe: 130 Zuhörende in Hof belauschen den Herzschlag der Saiten
Von Bach zu Mozart: Shunske Sato als Geiger und zugleich als Dirigent
Film
zuletzt
Wuthering Hights
Lolita lesen in Teheran
59. Internationale Hofer Filmtage
Mission Impossible - The Final Reckoning
Kleinkunst, Kabarett, Comedy
zuletzt
Erwin Pelzig macht in ernsten Zeiten ernst
TBC macht lauter gute Vorschläge
Olaf Schubert bewertet die Schöpfung
Philipp Scharrenberg verwirrt Bad Steben
Anderes
zuletzt
„Offenohrigkeit“: Ullrich Fichtner erlebt in aller Welt die Macht der Musik
Holländerinnen: Dorothee Elmigers Tropen-Horror ist ein Meisterwerk
Buch & Musik: Biedermanns „Lázár“ ein Flop, Spohrs Kammermusik wunderbar
Der neue McEwan: Mit dem Top-Romancier auf der Suche nach einem verlorenen Gedicht
Das neue Buch
SCHWEBENDE VERFAHREN - (2025) Vierzehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 436 Seiten, gebunden 25, als Paperback 18 Euro.
Solange in der Rechtsprechung oder der Verwaltung ein Vorgang „anhängig“ ist, sprechen wir von einem „schwebenden Verfahren“. Noch ist also kein Beschluss, kein Urteil ergangen. Dürfen wir beim Blick in die Vergangenheit von unwandelbar gesicherten Tatsachen sprechen, wenn wir bedenken, dass nichts beständig ist außer dem Wandel? Dass wir etwas für wert erachten, als „historisch“ festgehalten zu werden, wurzelt in unserem momentanen Blick. Nicht nur, aber vor allem auch davon berichten die Texte dieses Buchs. Was wir erleben und an Fakten sammeln, sind Etappen und vielleicht nur Augenblicke eines „schwebenden Verfahrens“: eines Prozesses, den wir Geschichte nennen. Das abschließende Urteil steht aus und wird nicht von uns gesprochen werden.
Im Buchhandel und online weiterhin erhältlich
KAISERS BART - (2022) Dreizehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 344 Seiten, gebunden 25, als Paperback 18, als E-Book 9,99 Euro.
Auch Kaisers Bart kommt vor in diesem Buch, zum Beispiel der des mittelalterlichen Staufers Barbarossa. Wenn wir uns indes heute „um des Kaisers Bart streiten“, dann geraten wir nicht wegen einer royalen Haupt- und Staatsaktion, sondern um einer Bagatelle willen aneinander. Dem Gewicht nach irgendwo dazwischen halten sich die Themen der dreizehn Essays auf, die alle dem weiten Feld der Kulturgeschichte entsprossen sind. Umfassend recherchiert und elegant formuliert, erzählen sie über Bücher und Bärte, Genies und Scheusale, über selbstbestimmte Frauen, wegweisende Männer und Narren in mancherlei Gestalt, über Stern- wie Schmerzensstunden der Wort- und Tonkunst. Worüber berichtet wird, scheint teils schon reichlich lang vergangen – „sooo einen Bart“ hat aber nichts davon.
VERPESTETE BÜCHER - (2021) Elf literarische Epidemien und ein Epilog. Von Michael Thumser. Mit Buchschmuck von Stephan Klenner-Otto. Verlag Tredition, Hamburg, 172 Seiten, gebunden 16,99, als Paperback 8,99, als E-Book 2,99 Euro.
Dieses Buch ist nicht das Buch zur Krise. Freilich ist es ein Buch zur Zeit. Es will einem traditionsreichen, aber noch unbenannten Genre der Weltliteratur einen passenden Namen geben: dem Seuchenbuch. Erstmals erschienen die literaturkundlichen Essays während der Corona-Pandemie auf dieser Website. Vermehrt um ein Kapitel über Mary Shelleys Roman „Der letzte Mensch“, wurden sie sämtlich überarbeitet. Den ausgewählten Werken der deutschsprachigen und internationalen Erzählkunst ist gemeinsam, dass in ihnen Epi- und Pandemien eine Hauptrolle spielen. So belegen die Werkporträts, dass die Furcht vor Seuchen und die Hilflosigkeit gegen deren raumgreifendes Wüten die Geschichte der Menschheit als Konstanten durchziehen. Die Beispielhaftigkeit der vorgestellten Seuchenbücher verleiht ihnen über ihre Epochen hinaus Wirkung und Gewicht.
WIR SIND WIE STUNDEN - (2020) Neunzehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 340 Seiten, gebunden 21,99, als Paperback 12,99, als E-Book 2,99 Euro.
Mehr oder weniger handeln alle hier versammelten Texte von Zeit und Geschichte, Fortschritt und Vergänglichkeit, von Werten und Werden, Sein und Bleiben, von Wandel und Vanitas. Zwischen 2010 und 2020 entstanden, wollen sie als Essays gelesen werden, folglich weniger als Beiträge zu den Fachwissenschaften, mit denen sie sich berühren, denn als schriftstellerische Versuche. Formal handelt es sich um sprachschöpferische Arbeiten eines klassischen Feuilletonisten, inhaltlich um Produkte von Zusammenschau, Kompilation und Kombination, wobei der Verfasser Ergebnisse eingehender Recherchen mit eigenen Einsichten und Hypothesen verwob, um Grundsätzliches mitzuteilen und nachvollziehbar darüber nachzudenken.
DER HUNGERTURM - (2011/2020) Dreizehn Erzählungen von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 288 Seiten, gebunden 19,99, als Paperback 10,99, als E-Book 2,99 Euro.
Von Paaren handeln etliche der dreizehn Geschichten in diesem Band: von solchen, die auseinandergehen, von anderen, die „trotz allem“ beieinanderbleiben, von wieder anderen, die gar nicht erst zusammenfinden. Dass die Liebe auch bitter schmecken kann, ahnen oder erfahren sie. Sich selbst und der Welt abhanden zu kommen, müssen manche der Figuren fürchten, den Kontakt zu verlieren, allein zu sein oder zu bleiben und nichts anfangen zu können, nur mit sich. Manche haben ihren Platz ziemlich weit fort von den anderen, zum Beispiel hoch über ihnen wie der namenlose Protagonist der Titelerzählung "Der Hungerturm". Irgendwann freilich werden sie aufgestört von der halb heimlichen Sehnsucht, mit jemandem zu zweit zu sein. Bei anderen genügt ein unerwarteter Zwischenfall, dass der Boden unter ihren Füßen ins Schwanken gerät und brüchig wird. Und es gibt auch welche, denen die Wirklichkeit in die Quere kommt, weil sie ein Bild von sich und Ziele haben, die nicht recht zu ihnen passen. Knapp und zielstrebig, bisweilen in filmartig geschnittenen Szenen und Dialogen berichten die zeitlosen Erzählungen davon, wie aus Unspektakulärem etwas Liebes- und Lebensbestimmendes, mitunter Tödliches erwächst.