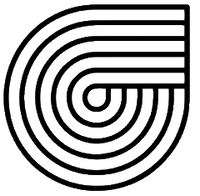Eckpunkte-Archiv 2022
Maschinenmusik
30. Juli Vor sechs Jahren verbreitete sich im Internet schlagartig ein Video, in dem, wie sein Urheber Martin Molin sagt, Musik ein „Spiel mit der Physik“ treibt. Oder ist es umgekehrt: Spielt Physik Musik? Sie tut es mithilfe der weitgehend aus Holz gezimmerten „Marble Machine“, die der schwedische Bandmusiker raffiniert ersonnen und monatelang selbst gefertigt hat: Im Innern ein verwickeltes Wegenetz durchquerend, rollen und fallen zweitausend Murmeln über komplexe Räder-, Walzen- und Hebewerke, um unter anderem ein Vibrafon, eine große Trommel und ein Becken zum Klingen zu bringen. In nur zwei Wochen ernteten Molin und seine Band Wintergatan – was so viel wie Milchstraße bedeutet – vierzehn Millionen Klicks für eine Sternenmusik, die sich Drehmomenten verdankt. An den Leierkasten etwa kann einen das erinnern. Seit einer Woche findet es eine andere, aktuelle Entsprechung in der Wilhelmshavener Kunsthalle, wo die Ausstellung „Cyclophilia“ (Liebe zum Rad) bis zum 18. September die Musikalität des Fahrrads erschließt, mit Verweisen etwa auf Frank Zappa und seinen einschlägigen Auftritt im US-Fernsehen 1963 und die Komposition „Catch Wave ’68#1“ des Japaners Takehisa Kosugi. Gar zum Geschäftsmodell erhob eine ähnliche Idee der Reutlinger Stefan Göggel, der sich als Ein-Mann-Band, Didgeridoo- und Sitar-Virtuose „GöG“ nennt und, in 125 Zentimetern Sitzhöhe auf einer selbstfahrenden Musikmaschine thronend, mit vielfältiger Tut-, Blas- und Geräuschmechanik die Menschheit erstaunt und bespaßt. Erfunden freilich haben sie alle die Verbindung von Klangkunst und kleinen oder großen Apparaturen nicht. Das Hämmern einer Schreibmaschine, nur als Beispiel, implementierte Erik Satie in sein Ballett „Parade“ von 1917 und ebenso Paul Hindemith in seine 1929 uraufgeführte komische Oper „Neues vom Tage“. Moritz Eggert besetzte 1997 seine „Symphonie 1.0“ gleich mit zwölf Schreibmaschinen, sah sich da aber schon im Voraus, nämlich 1964, himmelhoch getoppt durch Rolf Liebermann und „Les Échanges“ für 156 Büromaschinen einschließlich acht Klebestreifenbefeuchtern, dirigiert von einer elektronischen Steuereinheit. Neben derlei Pionierprojekten droht Leroy Andersons konzertanter Klassiker „The Typewriter“ von 1950 als possierlicher Gag zu verschwinden. In Boston fand sich ein „Typewriter Orchestra“ zusammen, eher kammermusikalisch besetzt. Weit größer wiederum dachte der US-Amerikaner George Antheil mit seinem „Ballet mécanique“, an dessen Trara- und Rabatzerzeugung sich mechanische Klaviere, elektrische Klingeln und Sirenen sowie zwei Flugzeugpropeller beteiligen – was 1926 und 1927 in Paris und New York denn auch angemessen krachende Skandale auslöste. Hingegen taugt seit 1994 die „Landmaschinensymphonie ST 210“ des Klangexperimentators und -objektkünstlers Erwin Stache bei den Stelzen-Festspielen bei Reuth Jahr für Jahr zum höchsten Pläsier des Publikums im sächsischen Vogtland: Dabei ersetzen Traktorenmotoren, Heuwender, Sägen und Förderbänder, aber auch eine „Gülleorgel“ und eine „Schaufelwasserdruckharfe“ ein komplettes Orchester. Über siebzig Jahre zuvor hatte der Franzose Darius Milhaud den „Machines agricoles“, den landwirtschaftlichen Geräten, bereits die Ehre einer symphonieorchestralen Suite erwiesen. Umfassend mit „Mensch – Maschine – Musik“ ist ein Buch aus dem Verlag C. W. Leske betitelt; die global wegweisende, international berühmte, populär-avantgardistisch auf elektronische Musik spezialisierte Band, von der es erzählt, ist (natürlich) „Kraftwerk“. ■
Der „Ring“ - ein Karussell
23. Juli Das gabs bei den Richard-Wagner-Festspielen noch nie: fünf neu inszenierte Musikdramen in einem einzigen Jahr. Und doch sind fünf eines zu viel: Die vier Teile des Nibelungen-„Rings“ so gut wie hintereinander weg zu dirigieren, das kann sich Cornelius Meister vorstellen; also springt er für seinen Kollegen Pietari Inkinen ein, der coronahalber die von Valentin Schwarz inszenierte Tetralogie heuer nicht wie vorgesehen leiten kann. Allerdings war Meister ursprünglich für den „Tristan“ – unter der Regie von Roland Schwab – engagiert. Doch man solls nicht übertreiben: Bei dem legendären Liebesdrama, mit dem am Montag der Festspielsommer auf Bayreuths Grünem Hügel startet, wird nun statt seiner Markus Poschner im „mystischen Abgrund“ des Grabens am Pult stehen. Das Karussell dreht sich. Und hat nicht erst Anfang des Monats der Bassist John Lundgren die Partien des Holländers und des Wotans abgegeben, „schwerer persönlicher Probleme“ wegen? Beim Umgang mit Absagen und Umbesetzungen kann sich die Festspielleitung auf eine gewisse Routine verlassen; muss doch jeder, der sich auf Wagners Riesendramen einlässt, mit mehr oder weniger „schweren Problemen“ rechnen. Dem „Meister von Bayreuth“ gings selbst nicht anders. 1857, mal wieder von Schulden gedrückt, unterbrach der Dichterkomponist die Arbeit am „Ring“ nach dem zweiten Aufzug des „Siegfrieds“, gleichsam zwischendurch trachtete er ein scheinbar klein dimensioniertes, darum allerorten leicht aufführbares Werk zu schaffen: die Tragödie um „Tristan und Isolde“; ein Vorhaben, das zumindest in dieser Hinsicht gründlich misslang. Denn die Partitur, die vom allerersten Orchesterakkord an mit allen tradierten Mustern und Modellen von Dramaturgie und Dur-Moll-Tonalität brach und von vielen Fachleuten denn auch zunächst verständnislos abgelehnt wurde, sie galt nach ihrer Vollendung als unrealisierbar. Ein geschlagenes halbes Jahr lang versuchten sich die Künstlerinnen und Künstler der Wiener Hofoper an dem Werk – um den Plan der Uraufführung nach 77 Proben schließlich frustriert fallenzulassen. Erst zwei Jahre später, am 10. Juni 1865 kam die „Handlung in drei Aufzügen“ unter königlicher Protektion in München heraus. Im Jahr 1876, bei der Eröffnung des Bayreuther Festspielhauses am 13. August, stand, wie des Meisters Gattin Cosima notierte, auch die allererste Aufführung des „Rheingolds“, als „Vorabend“ zum „Ring“, unter einem „vollständigen Unstern“: „Wotan verliert den Ring, läuft zwei Mal in die Kulisse während des Fluches, ein Arbeiter zieht den Prospekt zu früh bei der ersten Verwandlung heraus, und man sieht die Leute in Hemdsärmeln dastehen.“ Man bedenke: Dem teils blamablen Spektakel lieh Kaiser Wilhelm I. sein allerhöchstes Auge, ebenso sein brasilianischer Kollege Pedro II., auch waren berühmte Kollegen Wagners zugegen, Bruckner etwa und Camille Saint-Saëns, dazu prominente Künstler wie Makart, Lenbach, Menzel … Und die Sängerinnen und Sänger? Es ist, als müssten sie, um die höchste Ehre ihrer Zunft, nämlich Eingang in die heiligen Gefilde des Wagner-Gesangs, zu erlangen, einen schlimmen Pakt mit dem Schicksal (um nicht zu sagen: mit dem Teufel) unterzeichnen; denn arg viele ruinieren ihre Stimmen unter dem Gewicht der monströs-übermenschlichen Partien. Der erst 29-jährige Ludwig Schnorr von Carolsfeld, einer der großartigsten Tenöre seiner Zeit und gefeierter Gestalter des Tristans bei der Münchner Uraufführung, war nur fünf Tage später tot. Da soll man noch an Zufälle glauben. ■
Das Augenspiel
16. Juli Seit Albert Einstein geweissagt hat, dass „Gott nicht würfelt“, rätselt die Nachwelt, was der geniale Weltentschlüssler damit gemeint haben könnte. Damals, 1926, bezog sich der Physik-Nobelpreisträger auf die Quantenmechanik, aber deren Urgründe durchschauen bis heute nicht einmal die Fachleute. Da helfen dem oberflächlichen Verständnis Allegorien wie das des glücksspielenden Himmelsvaters durchaus weiter: Sollte alles in unserer Welt vorherbestimmt – mithin jeder und jede zu völliger Unfreiheit verdammt – sein? Müssen wir, was immer geschieht, für ein Spiel, Würfelspiel des Zufalls halten? Das würde all unser Wünschen, Hoffen und Verlangen als vergebliche Liebesmüh entwerten. Wäre dem so: Welchen Einfluss auf die Geschichte dürfen dann die sogenannten Großen wie Julius Caesar für sich beanspruchen? Als der 49 vor Christus den Rubikon überschritt, schrieb er sich in die Zitatenschätze nachfolgender Epochen mit dem Diktum ein: „Der Würfel ist gefallen“ – als hätte er schon bei jenem ersten Schritt geahnt, aus dem folgenden Bürgerkrieg letztlich ruhmreich als Sieger und Diktator auf Lebenszeit hervorzugehen. Vielleicht auch bediente er sich in Wirklichkeit der seinerzeit populären griechischen Redensart „Die Würfel mögen hochgeworfen werden“. In dem Fall hätte auch er den Ausgang seines Einmarschs für noch offen gehalten. Denn wer würfelt, verlässt den Boden der Sicherheit und wirft sich dem Zufall in die Arme, dessen Vollstrecker das Spielzeug ist. So harmlos ein handelsübliches Exemplar heute auch aussieht, so viel Mysteriöses birgt es doch in sich – nicht erst der Augenzahl wegen, die es von Wurf zu Wurf unvorherseh- und unberechenbar zeigt. Schon für sich genommen, hat der Würfel das Zeug zum kleinen Wunder: Denn obwohl all unseren Rechenkünsten die Quadratur des Kreises nicht gelingt, dürfen wir doch den Kubus für so etwas wie die ‚Quadratur‘ der Kugel halten. Mehr noch als er „fällt“, rollt der Würfel. Vermutlich quälen sich die weltweit etwa dreihundert einschlägigen Sammler selten mit derlei Rätseln, wenn ihr Blick über ihre Kollektionen schweift. Jakob Gloger ist einer von ihnen, über zehntausend Typen und Varianten, Spiel- und Abarten – auch aus Gold oder Edelstein, als Rasierpinsel, in den Plexiglas-Absätzen von High Heels oder mit sechs Lustpositionen aus dem „Kamasutra“ – trug der 29-Jährige zusammen. Jetzt wurde ihm die Ehre zuteil, mit seinen interessantesten Erwerbungen eine ganze Ausstellung in Leipzigs Stadtgeschichtlichem Museum bestücken zu dürfen; bis zum 18. September rekapituliert sie „5000 Jahre Glück im Spiel“, bis zurück zu Wurfstäbchen aus dem alten Ägypten. Ob Gott nun würfelt oder nicht – jedenfalls sind wir, ohne dass man uns um unser Einverständnis gebeten hätte, ins Dasein „geworfen“ worden und können seiner „Faktizität“ nicht entgehen; so viel macht der unverständliche Philosoph Martin Heidegger auch denen von uns begreifbar, die keine Einsteins sind. Zum Werfen braucht es Kraft und Schwung, allemal gehört etwas willentlich Gewaltsames dazu; gleichzeitig etwas zufällig Unwillkürliches: Denn wer, der sein Wurfgeschoss einmal aus der Hand entlässt, will garantieren, dass und wo es sein Ziel findet? Darum darf sich zwar unser caesarisches Überlegenheitsgefühl ruhmsüchtig bei Brett- und Würfelspielen austoben, doch sollten wir uns hüten, gegen andere „den ersten Stein zu werfen“: gut möglich, dass wir im Glashaus sitzen. ■
Duft in Dosen
23. Juni Immanuel Kant, der Erzphilosoph der deutschen Aufklärung, lebte als Königsberger Stadtbürger in einer Welt, die weitaus strenger roch, als wir es uns heute vorstellen können, in unseren vergleichsweise saubergeleckten Kommunen, von den Odeurs aus Deospraydosen, Rasierwasser- und Eau de Toilette-Flakons umwabert. Vielleicht auch wegen der Unausweichlichkeit der mehrheitlich ekligen Gerüche mochte Kant das Riechen nicht. Von den fünf Sinnen achtete er das Sehen, Hören und das fühlende Tasten hoch; hingegen sprach er dem Geruchs- und dem Geschmackssinn jeden Beitrag zur Erkenntnis ab. Den ausufernden Gegenentwurf dazu lieferte Marcel Proust von 1913 an: Die ersten Seiten seines Riesenromans „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschreiben, wie das bloße Aroma einer in Tee getauchten Madeleine den autobiografischen Icherzähler magisch in seine Kindheit und Jugend zurückversetzt, 4200 Seiten in sieben Bänden lang. Steht auch uns eine Tasse Tee und entsprechendes Gebäck zu Gebote, vermögen wir das Abenteuer immerhin im Ansatz nachzuvollziehen. Hingegen ahnen wir kaum, wie es in Kants Königsberg gerochen und gestunken haben mag. Oder wie roch es – so fragten dieser Tage etliche Zeitungen mit den Worten eines Agenturberichts – zu Zeiten des nur oberflächlich überfeinerten Barocks? In Jena erforscht das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, wie sich die mal schmeichelnden, mal abscheulichen Duftnoten vergangener Epochen so rekonstruieren lassen, dass unsere neuzeitlichen Nasen sie wieder wahrnehmen. Ähnliches unternimmt zurzeit ein berühmtes Museum in Spanien. Bis zum 17. Juli präsentiert der Prado auf sehr spezielle Art das Gemälde „Der Geruch“ aus der Serie über „Die fünf Sinne“, die 1618 die Freunde Jan Brueghel der Ältere und Peter Paul Rubens gemeinsam vollendeten. Es zeigt eine tiefenentspannte Nackte, wie Eva hingestreckt in einem Garten Eden voller bunter Blüten, saftiger Bäume, strotzender Früchte; ein Kleinkind oder Engelchen bietet ihr einen Blumenstrauß dar, neben sich hat sie Fläschchen und Döschen mit Salben und Düften ausgebreitet, auch leistet ihr, schwarz-grau gefleckt, eine Zibetkatze Gesellschaft, wie sie ihres Moschusbuketts wegen einstmals beliebt war. Zum synästhetischen Erlebnis wird das Schaustück durch das spanische Modeunternehmen Puig: Mittels einer „Air Parfum“-Technik versprüht es im Saal zehn zu den Bildmotiven passende Wohlgerüche, um die schnuppernden Betrachterinnen und Betrachter von heute vollends in die altflandrische Paradies-Vision zu entrücken. Pragmatisch betrachtet, kommen die hypnotisierenden Odeurs schlicht aus der Dose. Andere Dünste hingegen, sowohl willkommene wie jene von Wald, Feld und Flur, als auch widerwärtige, etwa der Dampf bäuerlicher Misthaufen oder die Gülle aus einem Schweinestall, vagabundieren frei im Freien und lassen uns die Heimat auf sehr reale Weise sinnlich erfahren. Darum forderten im Mai Bayerns Freie Wähler, jenes ländliche „Sinnes-Erbe“, ferner rurale Geräusche, unter rechtlichen Schutz zu stellen. Gut zu schützen wusste Piero Manzoni seine „Merde d’artista“, bevor er sie 1961 in neunzig Portionen unters Volk brachte: Abgefüllt in Konservenbüchsen, wird der Darminhalt des Italieners seither für Kunst ausgegeben. Als solche nähme Immanuel Kant die Dosen sicherlich nicht hin, wüsste sie aber in wenigstens einer Hinsicht zu schätzen: Man riecht nichts. ■
Doppelt und dreifach
16. Juni Wenn Robert Wilson, 81-jähriger Altstar und -meister des Gegenwartstheaters, Literatur auf die Bühne bringt, dann geht es ihm nicht zuletzt, vielleicht sogar vor allem, um Bilder. Wenn Francis Bacon, einer der erschrockensten Maler des leidvollen zwanzigsten Jahrhunderts, Gesichter schuf, dann waren es Grimassen des Entsetzens, furcht- und mitleiderregend verzerrt oder verstümmelt, verbogen oder zerquetscht. Wenn Oscar Wilde einen Roman schrieb – was er nur ein Mal tat –, dann wählte er als Thema das Gesicht eines jungen Mannes, schön wie ein Bild, das sich mit jeder Schandtat des hedonistischen Beaus mehr und mehr entstellt, während dessen eigene Züge engelsgleich bleiben, eine makellose Maske, die einen Lebenshunger ohne Rücksicht und Gewissen verbirgt. Aus derart dreifacher Wurzel – Dichtung, Spiel und Bildnerei – wächst seit der vergangenen Woche im Düsseldorfer Schauspielhaus (und dort im Schauspieler Christian Friedel) ein Monodrama zusammen. „Dorian“ nannte der US-amerikanische Erzähler, Dramatiker und Essayist Darryl Pinckney den Text, den Robert Wilson seiner szenischen Bilderflut wie eine dahinfließende Prosafantasie unterlegt hat. Sie erzählt davon, wie Francis Bacon in seinem Atelier einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt; doch liefert der homosexuelle Künstler ihn nicht der Polizei aus, sondern macht ihn zu seinem Modell und Geliebten. Dabei überblendet sich beider Begegnung mit jener, die „Das Bildnis des Dorian Gray“ entwirft; mit dem Roman etablierte Oscar Wilde 1890/91 erstmals die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern als Stoff der Literatur und löste so einen Skandal aus, die den schwulen irischen Poeten letztlich seine glanzvolle Stellung in Englands besten Kreisen kostete und ihn für zwei Jahre ins Gefängnis brachte. Eines der unwiderstehlichen Bücher der Weltliteratur: Der Maler Basil Hallward porträtiert den Titelhelden derart bezwingend, dass Lord Henry, vom Bildnis fasziniert, den kaum erwachsenen, unbefleckten, blühend wohlgestalteten Dorian wie ein Lebenslehrer unter seine Fittiche nimmt. Der Lord predigt ihm die Sünde, nicht aber, weil er ein Teufel wäre; sondern weil er meint, ein Mensch, der sich zu Besonderem auserwählt wisse, dürfe sich mit all seinem Streben, gerade auch dem nach Lust, über alle anderen erheben. Wirklich lässt sich Dorian bald dazu verführen, bedenkenlos Verderben über junge Frauen wie Männer zu bringen. Zusehends graben sich seine Vergewaltigungen der Moral, seine Opium- und erotischen Exzesse immer verhunzender, immer abscheulicher in sein Gesicht ein – nicht allerdings in seine eigenen, alterungslos vollkommenen Züge, sondern in die des Konterfeis, das er wohlweislich vor aller Augen verbirgt: Das Gemälde verkommt zur entlarvenden Fratze. In den Aphorismen, die Wilde dem Roman statt eines Vorworts voranstellte, dekretierte er, für den Künstler seien Tugend und Laster gleichermaßen Gegenstände der Kunst. Freilich sprach er, indem er sich in seinem Buch weidlich dem Laster widmete, der Tugend das Wort. Das Messer, mit dem Dorian, von Grauen vor sich selbst gepackt, sein Porträt vernichten will, steckt schließlich in seiner eigenen Brust. So offenbart er sich als tragische Personifikation des unberechenbaren Doppelgesichts, zu dem sich das Wesen eines jeden zusammenfügt: als Mensch in der Maske des Monsters und als Monster in Menschengestalt. ■
Über kurz oder lang
14. Juni Vom Scheitel bis zur Sohle misst der Schreiber dieser Zeilen 192 Zentimeter. Das ist lang, macht ihn aber nicht groß. Seinem Vater seligen Angedenkens verdankte er bereits in jungen Jahren die Empfehlung, vorsichtig zu sein beim Umgang mit kurzen Herren, „die auf dem Sofa sitzen und mit den Füßen nicht auf den Boden kommen“. Mit 1,82 Metern durfte auch der Herr Papa unter seinen Altersgenossen als verhältnismäßig lang gelten, obendrein, seines breitenwirksamen Berufes wegen, in seiner Heimatstadt als einigermaßen prominent. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Der Sohn jedenfalls profitierte von der Überlänge bestenfalls beim gymnasialen Basketballspiel. Dies deckt sich zum Teil mit Erkenntnissen von US-Forscherinnen und Forschern, die der verbreiteten Vermutung nachspürten, die Körpergröße eines Menschen wirke sich förderlich oder hemmend auf seine Lebensleistungen aus. Wirklich soll Kaiser Karl der Große, als mittelalterlicher „Vater Europas“, mit 1,84 Metern die meisten Zeitgenossen deutlich überragt haben; und der dieser Tage vor 350 Jahren geborene Zar Peter der Große maß baumlange 2,03 Meter. Dagegen mussten sich Adolf Hitler mit 1,75, sein Oberschreihals Joseph Goebbels nur mit 1,65 Metern bescheiden. Wladimir Putin, 1,70 Meter lang, rangiert ebenso unspektakulär in der Mitte. Die Experten gelangten in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass Körpergröße zwar unter Jugendlichen eine gewisse Prädominanz verleihe; jedoch greifen, ihrem Urteil zufolge, erwachsene Menschen auch bei himmelwärts strebendem Höhenwachstum nicht zwingend nach den Sternen der öffentlichen Achtung. Länge sorgt für Auffälligkeit, ermöglicht dem, der andere um Haupteslänge überragt, den Überblick und macht es ihm in Krisen leichter, selbstbewusst zu bleiben. Aber sie verleiht nicht automatisch gesteigerte Überzeugungskraft, bezwingende Ausstrahlung oder gar die Veranlagung zur Führerschaft. Wie ungerecht das Leben auch in dieser Hinsicht mit den Geschlechtern verfährt, erhellt aus dem Umstand, dass sich unter den Frauen die überdurchschnittlich großen, unter den Männern hingegen die unterdurchschnittlich kleinen Exemplare Sticheleien gefallen lassen müssen. Dabei kommen unter langen Lulatschen Luschen vor, so gut wie unter den zu kurz Gekommenen Genies. Erst recht einseitig verfährt die Geschichte mit dem Begriff der „Größe“: Beinah ausschließlich Männern schrieb sie das Attribut zu, neben dem genannten Kaiser Karl und dem Zaren Peter etwa dem makedonischen Kriegsherrn Alexander, dem römischen Kaiser Konstantin, dem Preußenkönig Friedrich II. … Im zwanzigsten Jahrhundert allerdings, der Epoche der größten Kriege, verfiel der Glaube an historische Größe endgültig und zu Recht. Aber noch 1888, kurz nach dem Tod des deutschen Kaisers Wilhelm I., trachtete sein Enkel gleichen Namens danach, den Großvater als vermeintlichen Reichseiniger offiziell zu „Wilhelm dem Großen“ zu befördern. Es wurde nichts daraus: Weder die öffentliche Meinung noch die Historikerzunft sprang darauf an. Dieser Tage nannte Putin, als selbst ernannter Garant neuer nationaler Stärke, sich in einem Atemzug mit Zar Peter: Über „Wladimir den Großen“ spötteln seither die Journalisten. Als einzige Frau der westlichen Geschichte erhielt Zarin Katharina II. den gloriosen Beinamen. Sie maß verschwindende 157 Zentimeter. ■
Moment mal!
6. Juni Nur einen Moment benötigt die Suchmaschine Google, um aus dem Internet sage und schreibe 39.300.000 Fundstellen zum Stichwort Momentum zu ziehen. Ganz so häufig unterläuft es uns im Alltag nicht, aber es kann uns durchaus auffallen, dass der Begriff seit noch nicht langer Zeit fast wie das Corona-Virus um sich greift. Erst unlängst, auf dem Öko-Gipfel „Stockholm+50“, mahnte die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke ein „neues Momentum für global gedachte Umweltpolitik“ an. Beim Deutschen Aktienindex DAX gibt es mal ein Momentum, und mal gibts keins. Investoren fassen angesichts der Rekordinflation eine akribisch durchdachte „Momentum-Strategie“ ins Auge. Kenner des Motorsports vermuten, dass der amtierende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beim Wettstreit mit seinem Konkurrenten Charles Leclerc „das Momentum auf seiner Seite“ habe. Wenn hierzulande über einen „Menstruationsurlaub“ wie den der Spanierinnen diskutiert wird, solle man - so lässt eine Sozialwissenschaftlerin sich zitieren -, das Momentum nutzen, um erst einmal für einen „offenen Umgang“ mit dem tabuisierten Frauenthema „Monatsbeschwerden am Arbeitsplatz“ zu sorgen. Kriegsberichterstatter kommentieren sich die Köpfe heiß, ob Russland in der überfallenen Ukraine das „Momentum verloren“ habe oder nicht … Was bekamen wir mit ihm endlich, das wir bisher offenbar schmerzlich entbehren mussten? Alltagssprachlich ist uns der Begriff Moment (ohne -um) vertraut, gleich in mehrfacher Bedeutung: Zum einen bezeichnet er, als Maskulinum, eine kurze Dauer, den Augenblick, gleichsam das Nu von „im Nu“; zum anderen, grammatisch als Neutrum, steht er für einen Um- oder Zustand oder Faktor, der etwas auslöst oder dafür den Ausschlag gibt; zum Dritten heißt so ein bestimmtes Merkmal oder Charakteristikum, etwa das Spannungsmoment eines Kriminalromans oder das retardierende Moment in der Tragödie. Im Englischen gibt es the moment in diesem Sinne auch; doch kennen Briten und US-Amerikaner überdies längst schon the momentum, womit sie den Schwung benennen, die Dynamik einer Sache, den Impuls. So, als Fremdwort wohl, haben wir es unserem Neudeutsch einverleibt, und nicht einmal ohne guten Grund. Denn im Lateinischen, vom Verb movere für bewegen abgeleitet, hat es seinen Ursprung, wo es Ver- und Umlauf bedeutet, Druck und Stoß, grundsätzlich eine Kraft, die einer Sache innewohnt und eine andere in Bewegung setzt. Mit Bezug auf Letztere verweist der Duden außerdem auf das so bezeichnete „Übergewicht“, das einst den „Ausschlag am Waagebalken“ gab. Was dies probate Wörterbuch – mit dem Hinweis „bildungssprachlich“ – außerdem vermerkt, ist die Bedeutung „rechter Augenblick“. So übersetzt, lässt sich das Wort tatsächlich auf das Unglück oder Glück im Sport, auf Gewinne oder Verluste an der Börse anwenden. Die Griechen der Antike sagten kairós dazu: der günstigste, leider flüchtige Augenblick. Ihn gelte es, empfahlen sie, unverweilt und mutig zu ergreifen und zu nutzen, als den Zeit-Raum, an dem sich die Chance der Chancen bietet, die Gelegenheit, die den meisten Ertrag verspricht, eine beim Schopf zu packende goldene Sekunde. Die trat in der Mythologie sogar leibhaftig auf, als Sohn des Göttervaters Zeus; das Hinterhaupt jenes Kairós war haarlos, während über seiner Stirn umso dichter eine Tolle flatterte. Die Franzosen sagen bon moment. Epochales lässt sich in ihm leisten; vielleicht auch birgt er nur eine angenehme Überraschung. Aber auch die können wir immer brauchen: Dem schönen Augenblick schlägt keine Stunde. ■
Ist es zu laut?
3. Juni Die Zeiten sind schlecht. So dachten alle Generationen vor uns, und heute scheint es uns wieder so. Und doch wird selbst unsere Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann zu einer „guten alten“ geworden sein, mögen uns auch die Welt und ihr Lauf gegenwärtig zu mancherlei schweren Sorgen, Bedenken und Verstimmungen Anlass geben. Aber sind die „Zeiten“, ist also das, was wir Menschen, irregeleitet und doch hochkultiviert, aus unserer Welt machen, wirklich derart schlimm, dass nun allenthalben gewarnt werden müsste? Was für eine Katastrophe gilt, bestimmt jede und jeder für sich selbst. Für den 1987 gestorbenen Gerald Moore, als Liedbegleiter zahlloser Klassikstars noch immer weltberühmt, wars der furchterregendste Gedanke, sein Klavierspiel könne dem Gesang übertönend gefährlich werden; so betitelte er denn auch seine Autobiografie in ironischer Bänglichkeit mit der Frage: „Bin ich zu laut?“ Eine Befürchtung, die uns heute, den Kriegslärm aus der Ukraine in den Ohren, nachgerade lächerlich erscheint. Aber die „Triggerwarnungen“, an die sich Theater und Kinos, Streaming-Dienste und Verlage zu gewöhnen scheinen, sinds nicht minder. Gern geht es im Film und auf der Bühne, in Romanen sowieso, ungeschminkt zur Sache – so mancher, des allzu Offensichtlichen längst übersatt, schaut schon nicht mehr hin. Gleichwohl meinen seit wenigen Jahren immer mehr Veranstalter, allzu schreckhafte Gemüter ihres Publikums rechtzeitig auffordern zu sollen, sich vor expliziten Szenen ausbrechender Lust oder Gewalt zu schützen: Nicht hinzuschauen, ist dann keine Reaktion des Überdrusses mehr, sondern eine der Übervorsichtigkeit. Sinn mag die Alarmmeldung haben, bevor schockierend krachendes Geräusch oder das Blitzgewitter eines Stroboskops einsetzt – für nicht wenige Zeitgenossen ein trigger, also Auslöser, von Migräne oder Herzbeschwerden. Aber bei Situationen, an die wir uns spätestens im Kino und Fernsehen der schambefreiten Achtziger und Neunziger akklimatisiert haben … ? Die Sensiblen stößt ja nicht erst das allzu Heftige, Krasse und Unschickliche vor den Kopf, schon ein scheinbar gleichgültiges Bild, ein unschuldiges Reizwort, ein Geruch kann einschüchternd oder aufschreckend an ein verdrängtes Trauma rühren; und solchen Zufällen vorzubauen, vermag der vorsichtigste Wille nicht. Andererseits müssen wir nicht jedes Ereignis, das uns in der Erinnerung beschwert, gleich für ein Trauma halten. Unsere Welt insgesamt ist oft abstoßend laut, grell, grausam, übergriffig, lächerlich, absurd. Sollen wir sie darum, selbst eingedenk der aktuellen Ängste, wirklich für schlechter halten als sie früher war? Russland hat in der überfallenen Ukraine den Krieg nicht erfunden; was im vergangenen Jahr in nicht weniger als 355 Kriegs- und Konfliktgebieten geschah, hat uns vor dem 24. Februar kaum den Schlaf geraubt und nicht ausgereicht, als Triggerwarnung vor Putins Krieg zu taugen. Nun aber schaukeln wir - unverhofft mit dem Kopf darauf gestoßen, wie privilegiert wir leben - unseren kollektiven Pessimismus hoch. Wer warnt uns vor uns selbst und den Schandtaten, die wir Tag für Tag an der Schöpfung begehen? Stimmt schon, diese Welt ist nicht von der Art, dass man sich ihr 24 Stunden am Tag ungeschützt aussetzen sollte. Und doch ist seit Menschengedenken jedes Zeitalter eines der Angst und eines der Hoffnung. Die Medien vermelden jedes Flugzeug, das vom Himmel fällt; von den unzähligen, die zum Glück oben bleiben, erzählt uns die Tagesschau nie. ■
Altlast des Grauens
21. Mai Wohl jeder und jede von ihnen sieht seither anders auf die Welt als zuvor; auf eine unheile Welt. Deutsche Soldatinnen und Soldaten, die bei Auslandseinsätzen in Afghanistan und Mali, im Irak oder Kosovo angegriffen oder in Feuergefechte verwickelt wurden, die Verstümmelung oder den Tod von Kameradinnen und Kameraden miterleben mussten, schleppen Bilder im Kopf mit sich herum, die sie so leicht nicht mehr loswerden – schon gar nicht ohne professionelle Hilfe. Viele schlafen kaum zwei Stunden in der Nacht oder werden von Albträumen, tags von Panikattacken, Schweißausbrüchen, Herzrasen, Atemnot geplagt; flashbacks versetzen sie unvermittelt in infernalische Situationen zurück; jedes laute Geräusch gerät zur Nervenprobe, sie werden reizbar, ziehen sich von ihren Nächsten zurück, verlieren das Vertrauen sogar zu ihren Liebsten …: Die „Posttraumatische Belastungsstörung“ wird zur Qual. Zum Glück stehen heute probate Therapien zur Verfügung. Als indes die Veteranen des Zweiten Weltkriegs in die zerstörte Heimat zurückkehrten, mussten sie mit dem Entsetzlichen, das sie überlebt hatten, allein zurechtkommen; nicht anders die Jungs und Mädchen, Partnerinnen und Mütter, die zu Hause Entbehrungen, Leid und Trauer, wenn nicht unmittelbare Gewalt erlitten hatten. Um sich selbst, die Familie, die Kinder zu schützen, behielten die meisten ihre furchtbaren Erinnerungen für sich. Die einen scheiterten in ihren Beziehungen. Den anderen gelang scheinbar der Weg aus dem Schrecken: Notdürftig verpflasterten sie die Wunden ihrer Seele, durch zwanghaftes Verdrängen, durch eisernes Schweigen. Unbewusst freilich und ungewollt gaben sie die Folgen ihrer Traumata sowohl an ihre Mit- und Umwelt als auch an die folgenden Generationen weiter. Erst in den vergangenen Jahren nahmen sich Autorinnen und Autoren in längst fälligen Publikationen des viel zu lang unterdrückten Themas an: so die Historikerin Miriam Gebhardt in „Unsere Nachkriegseltern“; oder Matthias Lohre in „Das Erbe der Kriegsenkel“; oder Sabine Bode. Sie darf sogar für sich in Anspruch nehmen, eine Pionierin bei der Aufarbeitung der Problematik zu sein. Auf „stille Themen“ spezialisiert, wie sie sagt – auch auf Demenz und Trauer –, hat sie es als mit vielbeachteten Bestsellern wie „Kriegsspuren“, „Nachkriegskinder“ und „Kriegsenkel“ zu jeweils zweistelligen Auflagen gebracht. In allen Titeln geht sie von dem unleugbaren Umstand aus, dass das Gros der heute Fünfzig- bis Achtzigjährigen bleibend unter dem Eindruck von Nazi-Diktatur und Krieg, Flucht und Vertreibung steht, gleichviel ob durch eigene Erfahrung oder Erziehung – und egal auch, ob es jenen Nachgeborenen nun bewusst ist oder nicht. Für den kommenden Mittwoch haben die Katholische Erwachsenenbildung und der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing die 75-jährige Journalistin und Autorin ins Hofer Pfarrzentrum Bernhard Lichtenberg zum Vortrag über „Die vergessene Generation“ eingeladen (Nailaer Straße 7, Beginn: 19.30 Uhr, telefonische Anmeldung: 0921/84868). „Die meisten Familien wissen nicht, dass das Päckchen, das sie mit sich herumtragen, aus dieser Zeit stammt“, sagt die Expertin. Das Grauen als unausrottbare Altlast – und als unfassbare Gegenwart: Wer löst den ukrainischen Soldaten, den Zivilistinnen aus Mariupol, die den erbarmungslosen Krieg der russischen Armee erdulden, die schlimmen Bilder wieder aus den Köpfen? Und wann? Und wie? ■
Die Erbsubstanz
17. Mai Manche sagen, so gut wie Luigi Miraglia spreche niemand sonst auf der Welt Latein. Nicht nur, dass der 56-Jährige vom Blatt weg Texte aus dem alten Rom lesen und verstehen kann; er vermag in der vermeintlich „toten“ Sprache des Imperiums lebendig zu parlieren. In Frascati bei Rom leitet er die Accademia Vivarium Novum, wo allsommerlich Menschen aller Altersgruppen täglich bis zu zwölf Stunden lang die Schulbank drücken, um es ähnlich weit zu bringen. „In zwei Monaten“, versicherte Miraglia der dpa, „lernt man hier mehr als in fünf Jahren auf der Schule.“ Dort indes, an den Gymnasien hierzulande, gilt Latein oft als Problemfach – dabei rangiert es nach Englisch und Französisch auf Platz drei der am meisten gewählten Fremdsprachen. Was jetzt also: „Tot oder lebendig!?“ So heißt eine am Freitag eröffnete Ausstellung, die bis zum 8. Januar im mittelalterlichen Kloster Dalheim bei Lichtenau im Kreis Paderborn den durch 2100 Jahre schwankenden, nie aber gegen Null gehenden Stellenwert der „Muttersprache Europas“ bemisst. Flüssig dahingeplaudertes Latein mag heute – wie Esparanto – als elitäre Geheimniskrämerei von Sprachverliebten gelten; und doch rettete sich die alte Sprache in mancherlei Gestalt bis in die Gegenwart. Dennoch rät Jürgen Gerhards, Soziologie-Professor in Berlin, davon ab, Kinder Latein lernen zu lassen. Zwar brachte es der Experte selbst bis zum großen Latinum. Doch davon ausgehend, „dass Lernzeit eine begrenzte Ressource“ sei, und angesichts der fortschreitenden Globalisierung sollten junge Menschen besser durch Englisch, Französisch, Spanisch ihre künftige Kommunikationsfähigkeit erweitern. Liebgewonnene „Sekundärfunktionen“ würden überschätzt: Der Forschungsstand zeige, dass an ihnen nichts dran sei. Gerade auf sie aber verweisen die Befürworter des Lateins, die in ihm sozusagen die Erbsubstanz der europäischen Kultur erkennen. Mit Blick auf seine geradezu modellhaft klare Architektur verweisen sie auf die Förderung des logischen Denkens, auf ein generell tieferes Verständnis für grammatikalische Zusammenhänge, auf Erleichterungen beim Erwerb anderer, namentlich romanischer Fremdsprachen. Und sie sind überzeugt: Wer in die alte Sprache und ihre Literatur eintauche, gehe in der Gegenwart mit vielen Fremdwörtern problemlos um und entwickle von Jugend auf ein Gefühl für Sprache ‚an sich‘ wie für etliche Sprachen des Kontinents; früh eigne er sich Methoden strukturierten Lernens an und erhöhe die eigene „Lesekompetenz“, die allgemein seit Jahren bedenklich sinkt; zudem erarbeite er sich einen Direktzugang zu Geschichte und Charakter des ausgedehnten christlich-abendländischen Kulturkreises. In dem diente Latein einst als Identität stiftendes Leitmedium und verbindende Verkehrssprache. Letzteres hat sich, zugegebenermaßen, sogar im Vatikan geändert. Dennoch werden nach wie vor sämtliche päpstliche Urkunden und Verlautbarungen auf Latein publiziert – wo doch die Welt heute voller Dinge steckt, von denen die alten Römer keine Ahnung haben konnten. Um diesem Manko abzuhelfen, erstellt die päpstliche Lateinakademie das „Lexico recentis Latinitatis“ mit über 15.000 gegenwartstauglichen Neologismen: „neapolitarum latronum grex“ für die „Räuberbande“ der Camorra, „acetaria aringorum“ für den Heringssalat, und (weniger überraschend) „praeservativum“ für das Kondom.
Wunderkammern
14. Mai Ein verlockenderes Wort können wir uns, wenn wirs recht bedenken, kaum denken: Museum. Rührt es doch von den Musen her, jenen unverwelklich jungen, weil göttlichen Damen der antiken Mythologie, die schützend ihre Hände über Künste und Wissenschaften breiteten und obendrein, sofern wir antiken Bildnissen glauben dürfen, sehr gut aussahen. Sie küssen, unter anderen, die Historiker und Astronomen, die Dichter sowohl verliebter Poeme wie gedankenvoller Epen oder vergnüglicher Komödien. Geheimnisvoll-wohlklingende Namen tragen sie: etwa Euterpe (zuständig fürs Flötenspiel) und Melpomene (Tragödie), Terpsichore (Tanz) oder Polyhymnia (Gesang und Saitenspiel). Mithin war das Museum, was wir heute nicht mehr in allen Museen feststellen, zunächst ein ‚Musenhof; empfänglich soll er uns machen für exzeptionelle Hervorbringungen des Geistes, die unseren Durchschnittsgeistern überlegen sind. Heute empfangen uns Museen neueren Gründungsdatums bisweilen in spektakulären Architekturen, die sozusagen selber Exponate, wenn nicht Wahrzeichen der sie beherbergenden Kommunen sind, und bereiten ihre Themen und Inhalte mit ausgeklügelten Inszenierungen aus. In ihnen verbinden sich eine pädagogisch fundierte Einprägsamkeit des Stoffs mit den Reizen des Ästhetischen und dem Pep des Unterhaltsamen. Das sah, wie die Älteren von uns wissen, früher anders aus. Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte ein Museumsbesuch einem endlosen Strafmarsch entlang nüchterner Vitrinen gleichkommen, deren pragmatische Präsentation angetan war, vor allem jugendliche Neugier spätestens nach einer Viertelstunde abzutöten. Unter anderem im Pariser Louvre, den Uffizien in Florenz, im Berliner Pergamonmuseum sahen sich 2021 André Meier und Tassilo Hummel um, als sie für Arte „Die Geschichte des Museums“ nachzeichneten; am morgigen Sonntag um 16.15 Uhr strahlt das Kulturfernsehen das Feature erstmals aus. Was wir heute für ein Museum halten, den Schauraum für eine mehr oder weniger wissbegierige Öffentlichkeit, das war es keineswegs von Anfang an. Ihren Ursprung hat es in den Schatzhäusern und Trophäenhorten der Antike, oft untergebracht in Weihestätten für jene Götter, die einem Reich im Krieg gegen ein anderes beigestanden hatten. Was später, zumal in der frühen Neuzeit, Aristokratie und Klerus an Raritäten zusammentrugen, kam an Stätten unter, die den schönen Namen Wunderkammer trugen und auch danach ausschauten: Bei weitem nicht allein künstlerisch Erlesenes und Wertvolles fand sich dort, sondern ebenso Absonderliches und Exotisches, ausgestopfte Tiere fremder Weltgegenden etwa oder, so in Dresdens Neuem Grünem Gewölbe, ein Kirschkern mit sage und schreibe 113 eingeschnitzten Gesichtern. „Kuriositätenkabinett“ hießen derlei Sammlungen folglich auch. Wer heute darüber klagt, dass es immer weniger Menschen zur Kultur ziehe, mag Trost aus den unabsehbaren Scharen saugen, die Jahr für Jahr die kleinen und großen Museen der Welt besuchen. Allein in Deutschland warens 2019 (also vor Corona) knapp 112 Millionen. Der Kultur dienen die Kollektionen, indem sie Vergangenes sowohl instand setzen und aufbewahren als auch vorzeigend lebendig halten und vergegenwärtigen. Nicht zuletzt mit ihren Internetauftritten, mit denen sie sich freilich selber Konkurrenz machen, beweisen viele, wie modern sie sind. ■
Worte sind Waffen
11. Mai Unterhalb der Düsseldorfer Tonhalle ist eine junge Autorin im Anorak schreibend am Werk, auf dem Kopf eine gelbe Mütze, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Taschenbuch, in der rechten einen Filzschreiber. Vera Vorneweg steht vor einem Container, dessen Großflächen sie mit endlosen Zeilen ihrer engen Handschrift bekritzelt. Eigene „poetische Gedanken“, sagte sie vor wenigen Wochen, fielen ihr angesichts des entsetzlichen Ukrainekriegs nicht ein. Den Text für ihre Freiluftschreiberei entnimmt sie darum einem Buch, das binnen gut 130 Jahren in zig Auflagen, Ausgaben und Sprachen gedruckt wurde: „Die Waffen nieder!“ Die fiktive Autobiografie einer couragierten österreichischen Aristokratin: Ihr Leben und Leiden und das ihrer Familie breitet sie aus vor dem historischen Hintergrund von nicht weniger als vier europäischen Gemetzeln. Der erste Gemahl kehrt aus dem Krieg nicht zurück, den Österreich 1859 gegen Sardinien und Frankreich verliert. Der zweite zieht 1864 und 1866 erst in den Deutsch-Dänischen, dann in den Deutschen Krieg; und überlebt beide; nicht aber den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71: Als vermeintlichen Spion Preußens durchsiebt ihn ein Erschießungskommando. Bertha von Suttner, die 46-jährige, entschlossen pazifistische, bald weltberühmte Verfasserin des Buchs, war als Komtesse Kinsky 1843 in Prag zur Welt gekommen und hatte sich als „höhere Tochter“ Literatur, Sprachen und feine Lebensart begierig einverleibt. Derart qualifiziert, konnte sie es wagen, auf ein verlockendes Inserat Alfred Nobels zu antworten, als der nach einer kultivierten, polyglotten Sekretärin und Hausdame suchte. Zu Reichtum und Weltruhm hatte ers mit seinen Erfindungen gebracht, vor allem mit dem Dynamit, mit dem es ihm gelungen war, die unberechenbare Sprengkraft des Nitroglyzerins zu zähmen. Berg-, Straßen und Kanalbau profitierten davon – desgleichen die Kriegsindustrie. Folglich machte sich Nobel Gedanken über die Explodierbarkeit der Welt und über den Frieden auf ihr – und infizierte mit ihnen seine Gesellschafterin. Später, von Georgien aus, dokumentierte Suttner mit ihrem Mann Arthur die Gräuel des russisch-türkischen Konflikts 1877/78 – woraus „Die Waffen nieder!“ erwuchs, eine Inkunabel der Antikriegsliteratur. Schließlich veranlasste sie Nobel, unter die von ihm ausgelobten Auszeichnungen auch eine für den Frieden aufzunehmen. Neun Jahre nach dem Tod des schwedischen Erfinders erhielt sie, als Siebte der Geehrten und erste Frau, den Friedensnobelpreis selbst. Ihr Roman, weniger seiner literarischen Qualitäten als seines zeitlos brisanten Stoffes wegen bedeutend, erschien in einer Periode, da Europa neuerlich um seinen Frieden fürchten musste: Mit Wilhelm dem Zweiten saß ein nicht zuletzt gegen Frankreich gedankenlos agitierender Monarch auf dem deutschen Kaiserthron; und jenseits des Rheins hoffte der „Erbfeind“ seinerseits darauf, die Schmach von 1871 alsbald auszutilgen. Auch Worte, ob auf den glatten Seiten eines Buchs oder dem welligen Blech eines Containers, können als Waffen taugen. Heute darf Vera Vorneweg, die Düsseldorfer Schriftstellerin, hoffen, irgendwann das Ende des Ukrainekriegs zu erleben. Ihrem Idol Bertha von Suttner blieb es gnädig erspart, aufs Furchtbarste ihre Hoffnungen scheitern zu sehen: 1914 schloss sie in Wien die Augen, genau eine Woche vor den Todesschüssen von Sarajevo, dem Todesstoß für das alte Europa. ■
Aktion Wort
20. April Darf eine Offenbarungsreligion auf Geheimwissen gründen? Natürlich nicht, antworten heute wohl die meisten von uns wie selbstverständlich. Aber anderthalb Jahrtausende lang teilte sich unter unseren Vorfahren das Christentum nur einem auserwählten kleinen Kreis mit: denen, die zu lesen verstanden; noch dazu in einer ehrwürdig alten, künstlich am Leben erhaltenen Sprache, die alles andere als Volkssprache war: auf Latein. Wer als mittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Analphabet – und das waren damals fast jede Frau und jeder Mann – die Kirche aufsuchte, erlebte die Messe als Mysterium, nicht jedoch als Botschaft, und um die biblischen Heils- (und Unheils-) Geschichten kennenzulernen, sah er sich auf den Bildschmuck der Gotteshäuser und auf mündliche Erläuterungen, etwa durch ältere Familienmitglieder, verwiesen. Wenn es uns, wie einst den Doktor Faust, heute drängt, den „Grundtext“ aufzuschlagen, so stehen uns reihenweise brauchbare Übersetzungen zur Verfügung. Hingegen muss das Universalgenie in Johann Wolfgang von Goethes genialem Trauerspiel, als es sich nach „Offenbarung“ sehnt und sie im Neuen Testament zu finden hofft, sein eigener Dolmetscher werden. Der „Grundtext“, den Faust – in der berühmten, poetisch schwer zu übertreffenden Studierstubenszene – aufschlägt, steht in der altgriechischen Sprache des „heiligen Originals“ geschrieben, und furchtlos schickt der Gelehrte sich an, ihn in sein „geliebtes Deutsch zu übertragen“. Doch schon die erste Zeile des Johannes-Evangeliums lässt den Grübler stocken: „en arché en ho logos“. Unvermittelt bekommt ers gleich mit einem so mystischen wie monumentalen Kernbegriff der Theologie zu tun: logos – Schöpfungsspruch, Gottesgeist, Himmelswille, Urvernunft …, all das und mehr bedeutet er (und wiederum von allem nur etwas). Wie soll Faust ihn fassen: „Im Anfang war das Wort“? Er kann „das Wort so hoch unmöglich schätzen“. Darum versucht er Varianten: „Sinn“; „Kraft“; und schreibt am Schluss „getrost: Im Anfang war die Tat.“ Zu einer Tat, geeignet, Geheimes aufzudecken, schritt der Doktor Luther vor fünfhundert Jahren: Zwischen dem 18. Dezember 1521 und dem Februar des Folgejahrs übertrug er windeseilig das Neue Testament komplett ins Deutsche, in einer Diktion, die, nach gründlicher Durchsicht durch seinen Freund Philipp Melanchthon – einen Altphilologen der Spitzenklasse – und nach mancherlei Überarbeitungen und Anpassungen bis heute, nicht nur den Protestanten als schwer zu übertreffen gilt. Im Herbst 1522 ging das Projekt in Druck, dem Erscheinungsmonat folgend als „Septembertestament“ – eine für unabsehbare Zukunft maßstabsetzende Aktion. An fremden Maßstäben musste sie sich zu ihrer Entstehungszeit messen lassen, reicht doch die Geschichte der deutschen Bibel viel weiter zurück: Vor Luther hatten bereits achtzehn Übersetzungen von anderer Hand die Druckereien verlassen; freilich keine mit der Sprach- und Bildkraft des Reformators. Wort oder Tat? Die Szene, darin Goethes Faust nach dem einzig wahren Ausdruck sucht, offenbart uns viel über das Wagnis jedes Übersetzens. Wer es unternimmt, muss zwischen Wortlaut und Bedeutung balancieren und sich auf Zwischentöne und Ausdrucksnuancen einstellen. Ein Höchstmaß an Verantwortung lastet gar auf ihm, geht es um Schriften, die Milliarden Menschen heilig sind. „Sprechakt“ nennen Linguisten alles, was zwischen Mensch und Mensch gesagt wird: Auch unser Wort ist eine Tat. ■
Mordsrummel
9. April Ein paar unserer Wörter, Fremdwörter zumeist, überraschen mit doppelten Bedeutungen, deren eine paradoxerweise das Gegenteil der anderen bezeichnet. Zum Beispiel sanktioniert eine Behörde etwas, wenn sie es billigend zulässt; zugleich sanktioniert die freie Welt das kriegerische Russland, indem sie es für seine Gräueltaten in der Ukraine bestraft. Nicht minder janusköpfig die Passion: Zum einen nennen wir so die Leidensgeschichte eines Menschen, im Besonderen die des neutestamentlichen „Menschensohnes“ Jesus Christus, an deren Vollendung sich die Christenheit in sechs Tagen am Karfreitag erinnert; zum andern klassifizieren wir mit dem Wort, ganz im Gegensatz dazu, ein Hobby, dem wir uns nicht allein zum vergnüglichen Zeitvertreib, sondern mit Leidenschaft zum höheren Lust- und Erkenntnisgewinn hingeben. Passion heißt überdies ein Bezahlsender des Hauses RTL, der eigenen Angaben zufolge „neben bekannten soaps wie ‚Alles was zählt‘ und ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ einige Klassiker im Programm hat, darunter ‚Dallas‘ oder ‚Hinter Gittern‘.“ Auch ohne dem Medienunternehmen RTL Gottlosigkeit vorzuwerfen, könnte man meinen, dass sich der unter unmenschlichen Schmerzen zu Tode gefolterte Nazarener in solch ein Profil schwerlich einfügt. Doch ausgerechnet seiner „Passion“ wendet es sich in seinem kostenlosen TV-Programm nun umso hingebungsvoller und leidenschaftlicher zu und feiert am Mittwoch kommender Woche, also zwei Tage vor Karfreitag, Ostern gleich mit. Denn „nun wird Jesus Christus erneut zum Leben erweckt“, verheißt die Website des Unterhaltungskanals – und diesmal wacht der Messias „in der heutigen Zeit auf, begleitet von richtigen Popkrachern“ und als „Live-Event“ inszeniert „von einem Aufgebot an bekannten Stars der Gesangs- und Schauspielszene“. Womit dürfen wir rechnen? Gerät die Aburteilung des schlichten Predigers Jesus, die aller juristischen Fairness hohnsprach, jetzt als „größte Geschichte aller Zeiten“ zum pompösen Schauprozess gegen einen präpotenten A-Promi namens „Jesus Christ Superstar“? (Man wird sehen.) Werden die erhofften Zuschauermassen der Kreuzigung – wohlgemerkt einer der qualvollsten und demütigendsten Formen der öffentlichen Hinrichtung überhaupt – mit jener gottesdienstlichen Andacht und mitleidenden Demut beiwohnen, wie sie wohl das Gros des Oberammergauer Passionsspiel-Publikums empfindet? (Wenig wahrscheinlich.) Wird Gottvater den Aktionismus, mit dem das schmähliche irdische Ende seines als Erlöser vorgesehenen Sohnes zum Sensationsspektakel hochgespuscht wird, diesmal sanktionieren – soll heißen: einverständig durchgehen lassen? Zwei Mal tat ers nicht: 2020 und 2021 musste der Mordsrummel coronahalber abgesagt werden. Heuer hingegen scheint der Allmächtige, mit mehr Humor, nicht zu Plagen, Heimsuchungen und sonstigen Sanktionen aufgelegt. Mithin wird am 13. März auf dem Essener Burgplatz Alexander Klaws – 2003 der erste der von Deutschland „gesuchten“ und gefundenen „Superstars“ – den Heiland geben; die Verbrecher-Rolle des Barabbas ist mit dem knasterfahrenen Martin Semmelrogge adäquat besetzt; unter die Jünger mischen sich „Dschungelkönig“ Prince Damien und Nicolas Puschmann, der es schon zum „Prince Charming“ brachte. Und als Erzähler der Heilsgeschichte kam für RTL überhaupt nur einer infrage: Thomas Gottschalk. Immerhin heißt der mit der Hälfte des Nachnamens wie der Vater im Himmel und mit dem Vornamen wie einer der zwölf Apostel, wenn auch ein ungläubiger. ■
Frieden wäre gut
5. April Was ist der Mensch? So lautet eine der Grundfragen der Philosophie. Wie ist der Mensch? Diese Frage stellen wir uns dieser Tage wieder dringlich. „Der Mensch ist von Natur böse“, dekretierte Immanuel Kant: Schlichtweg niemand von uns, so lehre die Erfahrung, könne „anders beurteilt werden“, wir müssten das Böse „in jedem, auch dem besten Menschen voraussetzen“. Harte Worte. Wenn wir freilich in die Ukraine schauen und die Gräuelmeldungen über das Massaker von Butscha abwägen, so mögen wir an naturgegeben Gutes bestenfalls im schwächeren Teil der Menschheit glauben, der den rücksichts- und gewissenlosen Starken unterliegt. Oder sollten wir dennoch hartnäckig Optimismus wagen? „Der Mensch ist von Natur aus gut, und ich glaube, es nachgewiesen zu haben“, da war sich Kants Denker-Kollege Jean-Jacques Rousseau sicher: Fest hielt er dafür, dass alle Menschen gleich geboren und dazu bestimmt seien, glücklich und zufrieden zu leben, denn das entspreche ihrem „Naturzustand“. Dem komme allerdings das Eigentum in die Quere: Erst Besitz nämlich schaffe Ungleichheit, und erst aus ihr erwüchsen Unmut und Misstrauen, Neid und Gier und, unter Völkern, Krieg. Für hoffnungslos hielt Rousseau die Lage gleichwohl nicht: In seiner maßstabsetzenden Schrift „Über den Gesellschaftsvertrag“ entwarf er 1762 die Utopie eines „Zusammenschlusses von freien Bürgern auf der Grundlage gleicher Rechte“ und eines „Gemeinwillens“, dem die Einzelnen in einem Pakt ihre eigenen Willen in freier Entscheidung unterordnen. Schön wärs, wenn das so einfach wäre (und natürlich ist es auch in Rousseaus Schrift, einem Grundbuch der Demokratie, bei Weitem komplizierter). Im konfliktreichen Verhältnis der Nationen, so fand wiederum Immanuel Kant gut dreißig Jahre später, lasse sich die „Bösartigkeit der menschlichen Natur unverhohlen blicken“, unser „Naturzustand“ sei kein friedfertiges Miteinander, sondern eine „immerwährende Bedrohung mit Feindseligkeit“ bis hin zum „Kriegszustand“. Was tun dagegen? Auch Kant wagte eine Art Utopie – in seiner kleinen Altersschrift „Zum ewigen Frieden“, worin er die Blaupause eines Friedensvertrags entwirft. Darin sieht er vor: dass Friedensschlüsse ohne alle Vorbehalte vereinbart werden sollen; und dass ein Staat nicht zu einer Sache verkommen dürfe, die man erben, eintauschen, kaufen, verschenken könne; stehende Heere müssen abgebaut werden; kein Staat darf Schulden machen, um Krieg zu finanzieren; kein Staat darf sich gewaltsam in die Regierung und Verfassung eines anderen einmischen; und schließlich: Nie dürfen Feindseligkeiten so weit führen, dass sie „das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen“. Den Krieg „als Rechtsgang“ schloss Kant grundsätzlich aus, Frieden zu halten, nannte er eine „unmittelbare Pflicht“ der Vernunft. Von der, dem Surrogat seines Denkens, ausgehend, schlug auch er, wie Rousseau, einen „Zusammenschluss“ vor: eine Allianz europäischer Republiken auf der Basis von „Vertrauen“ und „freiem Föderalismus“, „Völker“- und „Weltbürgerrecht“. Heute sind die meisten Länder des Kontinents unter der Friedensordnung der Europäischen Union geeint – und sehen gleich in der Nachbarschaft den Rauch eines brennenden Kriegsgebiets aufsteigen. Inspiriert hatte Kant übrigens eine Kneipe, deren Schild den Namen des Hauses, „Zum ewigen Frieden“, nannte. Ein Friedhof war darauf gemalt. ■
Gleich knallts
2. April Die Aufregung ist groß, aber die Leute sollen mal nicht so tun, als kennten sie dergleichen nicht schon längst: Prügel auf offener Bühne sind keine Seltenheit, und schon gar nicht hat sie Will Smith erfunden, als er bei der jüngsten Oscar-Gala den Moderator Chris Rock abwatschte. In unzähligen filmischen Beziehungskisten setzen Wangenstreiche dramaturgische Akzente, wenngleich sie zumeist von aufgebrachten Damen in Gesichtern von Männern platziert werden, die sich ihnen zuvor handgreiflich oder verbal missliebig machten. Mag die Klatsche dann auch eine Übergriffigkeit bestrafen, so muss doch auch sie selbst in jedem Fall als solche gelten. Zwar wurde die causa Smith sofort und zu Recht als Tiefpunkt in der Karriere des US-Filmstars und als Anschlag auf die Tradition der Academy Awards apostrophiert, aber sie bestätigt zugleich, wie lüstern der Mensch dorthin schaut, wo Fäuste oder auch nur flache Hände fliegen. Kein Wunder, dass sich sogar in der gehobenen Kultur Hiebe von mancherlei Art ereignen, wiederholt beispielsweise im Musiktheater, nicht zuletzt bei Richard Wagner, dem als „Meister von Bayreuth“ wohl ersten Tonsetzer der oberfränkischen Musikgeschichte. In seinen „Meistersingern von Nürnberg“ befördert Schuhmachermeister Hans Sachs den brav vor ihm knienden Lehrburschen David zum Gesellen, indem er ihm eine kräftige „Schell“ herunterhaut, doch das ist noch gar nichts. Weit gewaltsamer hat das Bühnenvolk der Oper sich kurz zuvor in einer veritablen Klopperei aufgemischt, angefeuert von einem Orchesterstück, das als „Prügelfuge“ legendär und bei Dirigenten wie Regisseuren gefürchtet ist. Harmlos wirkt dagegen die Szene aus Cole Porters Musical „Kiss me, Kate“, in der Frauenschwarm Fred die eifersüchtige Lilli lachend coram publico übers Knie legt; scheinbar harmlos: Wann wohl sähe Männlichkeit „toxischer“ aus. Eine Keilerei zwischen zwei Frauen wars allerdings, was am 6. Juni 1727 dem Opernbetrieb in London vorübergehend ein schmähliches, vom Publikum freilich sensationsgierig verfolgtes Ende bereitete. An jenem Tag stand in dem von Georg Friedrich Händel geleiteten King’s Theatre die letzte Vorstellung vor Saisonschluss an – zugleich vor der Sommerpause die letzte Gelegenheit für Faustina Bordoni und Francesca Cuzzoni, ihren Dauerzwist endgültig auszufechten. Als gefeierte Sopranistinnen konkurrierten die Damen um die Gunst des Publikums, das sich je zur Hälfte einer von beiden zuwandte und die je andere vergnügt durch Zischen, Zoten und weitere Zumutungen aus der Fassung zu bringen suchte. Lange zuvor schon hatten die Künstlerinnen einander mit hate speech, fake news und Komplotten überzogen. Nun war das Fass voll, und Weiber wurden zu Hyänen: Während der Aufführung gingen die entflammten Damen aufeinander los, zerfetzten einander die prächtigen Kostüme und rupften sich fingernagelscharf die Perücken von den zornrot zerkratzten Köpfen. Die Galerie raste vor Entzücken, der Prince of Wales indes war not amused. Wenig später kolportierte ein Pamphlet den Schlagabtausch als „most horrid and bloody battle“, als „allerscheußlichste und blutige Schlacht“. In Los Angeles floss immerhin kein Blut. Freilich, Chris Rocks Wange brannte sicher wenig angenehm. Gleichwohl fand Will Smith mit seiner filmreifen Attacke weltweit so umfassende Beachtung, dass der Oscar, den er kurz darauf auf demselben Podium entgegennahm, beinah wie eine spontane Auszeichnung für seine Backpfeife aussieht. ■
Die Nacht zum Tage
26. März Wenn wir die Nacht zum Tage machen: Wo bleibt sie dann, die Nacht zum Tage, also das schwarze, Zurückgezogenheit, Seelenfrieden, Intimität begünstigende Gegenstück zum Frühlingssonnengold unserer glühenden und schillernden Betriebsamkeit? So rücksichtslos wir die Natur mit den technischen, landwirtschaftlichen, infrastrukturellen Notwendigkeiten unseres Daseins und mit der Flut seiner Abfallprodukte vergiften, so ruinös ignorieren wir den seit Ewigkeiten festgeschriebenen, uns überhaupt erst vitalisierenden Wechsel zwischen der Sichtbarkeit der Welt und dem Dunkel, in das sie sich hüllt, um uns, buchstäblich, in Ruhe zu lassen. Luftverschmutzung nennen wir die Verunreinigung unserer Atmosphäre und ihre Sättigung mit klimaschädlichen Substanzen; durch Lichtverschmutzung hingegen degradieren wir das Licht selbst zu einer Art Smog; freilich unverdient: gehört es doch, wie die Luft, das Wasser, die Böden, zu den wesentlichen Urelement unseres Erdenwandels; erst der unbedenklich ausufernde Umgang mit ihm lässt es zu einem Unrat verkommen, der Schäden anrichtet. Zu Herren und Herrinnen über den Rhythmus von Tag und Nacht werfen wir uns auf (und gebärden uns mithin fast so, als gehorchte uns die Rotation des Planeten); dadurch aber muten wir nicht uns allein, sondern einem Großteil der Organismen um uns herum eine Lebensweise zu, die dem seit Abermillionen Jahren vererbten biologischen Alternieren von Wachsein und Stillstand, Produktion und Pause, Ressourcenverbrauch und Regeneration grundsätzlich zuwiderläuft. Uns Menschen, die auch nachts so tun, als hätte unser helllichter Tag vierundzwanzig Stunden, warnen Wissenschaftler vor Krankheiten, die fehlender oder gestörter Schlaf auslöst oder fördert. Unter den Tieren, von denen wohlgemerkt über sechzig Prozent nachtaktiv sind, erkennen Experten massenhaft massive Verwerfungen bei Abläufen der Beutesuche, Fortpflanzung und, nicht zuletzt, bei der Bestäubung von Pflanzen. Die Vegetation, zumal in Städten und Ballungsräumen, vermag nicht mehr zwischen lange hellen Sommer- und dunklen, kurzen Wintertagen zu unterscheiden. All das - so viel - weiß man schon; dabei sind einschlägige Forschungen noch kaum über die Anfangsgründe hinaus gediehen. Um ein Zeichen gegen die Lichtverschmutzung und für den Klimaschutz, zudem im Angesicht des Ukraine-Kriegs für ein friedliches Zusammenleben auf dem Globus zu setzen, gehen am heutigen Samstag an vielen Orten der Welt, auch in Deutschland, auch in der Region die Lichter aus. „Earth Hour“ heißt die seit 2007 jährliche Aktion, die dafür wirbt, für eine Stunde jedes nicht unbedingt benötigte Licht zu vermeiden. In Hof verdunkeln sich um 20.30 Uhr die Straßen im Stadtteil Wölbattendorf, ferner Rathaus und Volkshochschule Hofer Land, St.-Michaelis- und Marienkirche, Freiheitshalle und Theater. Widerspruch könnte indes aus Wolfsburg kommen: Macht Licht, scheint bis zum 10. Juli eine Ausstellung im dortigen Kunstmuseum zu fordern; doch auch sie verlangt nicht nach Dauer-Bestrahlung. Denn bei genauem Lesen fallen zwei Ausrufezeichen im Titel auf: „Macht! Licht!“ lautet er und verweist auf das, worauf die Objekte und Installationen verweisen – auf die Schattenseiten jeder Erleuchtung. Wer über das (elektrische) Licht verfügt, herrscht über die Welt. Wer aus dem Licht gerät, kommt abhanden, denn die im Dunkeln sieht man nicht. ■
Die Büx ist unisex
19. März Männer dürfen es sich zum Glück längst nicht mehr erlauben, Frauen als das zwar „schöne“, aber „schwache Geschlecht“ hochmütig kleinzureden. Als das „andere Geschlecht“ beschrieb Simone de Beauvoir 1949 die Frauen, im französischen Original als „Le Deuxième Sexe“, als das „zweite“, will sagen, das andere, von Natur aus gleichberechtigte Geschlecht. Der berühmten Philosophin und ihrer Grundschrift des Feminismus widmet die Bundeskunsthalle in Bonn zurzeit eine Ausstellung, die Beauvoirs vielzitierte Grundthese einkreist: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ 1908 geboren, begegnete die Denkerin vielen patriarchalischen Verdikten in ihrem eigenen Leben. So war sie schon etwa sechzig, als es auch für Frauen statthaft wurde, Hosen zu tragen. Zuvor hatten sich dagegen gerichtete männliche Vorbehalte auf die Bibel stützen können, die im fünften Buch Mose warnt: „Ein Weib soll nicht Mannsgewand tragen, und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun; denn wer solches tut, der ist dem HErrn, deinem Gott, ein Gräuel.“ Als bekennende Atheistin dürfte Simone de Beauvoir die Weisung zwar ignoriert haben; gern legte sie Krawatten um. Aber ob sie, ab dem Ende der Sechzigerjahre, wohl auch Hosen trug? Sie selbst berichtete von den Vorbereitungen auf eine Lesereise durch die iberische Halbinsel nach dem Zweien Weltkrieg, für die sie sich komplett neu einkleidete: „Drei Paar Schuhe, eine Handtasche, Strümpfe, Wäsche, Pullover, Kleider, Röcke, Hemden, eine weiße Leinenjacke und einen Pelzmantel“ legte sich die (1986 gestorbene) Koryphäe damals zu, die sich bis in ihre letzten Jahre in schicken Kleidern und Röcken präsentierte; von Hosen ist indes nicht die Rede. Gleichwohl irrt, wer die Hose exklusiv für ein „Mannsgewand“ – und den Rock für ein typisches „Weiberkleid“ – hält. Als die gebildeten Stände Zentraleuropas im achtzehnten Jahrhundert durch Gemälde, Buchillustrationen und grafische Mappenwerke allmählich einen halbwegs authentischen Eindruck vom Treiben der Menschen im „Morgenland“ erhielten, staunten sie nicht schlecht über die Pluderhosen, die von der Hüfte abwärts die Beine auch der Orientalinnen bequem umspielten. Erst recht diente der Rock, als ein um die untere Körperhälfte geschlungenes rechteckiges Tuch, oder, von den Schultern herabfallend, das lange Obergewand jahrtausendelang beiden Geschlechtern; in vielen Teilen der Welt ist dies noch heute so. Während etlicher Jahre rekonstruierten Expertinnen und Experten der Eurasien-Abteilung im Deutschen Archäologischen Institut zu Berlin die älteste erhaltene Hose der Welt: Sie wurde, wie die Forschergruppe um Professor Dr. Mayke Wagner jetzt mitteilte, vor etwa 3200 Jahren aus mehreren gewebten Teilen gefertigt und tauchte in einem Gräberfeld im Westen Chinas auf. Die wollene, attraktiv verzierte Büx, vermutlich aus dem Besitz eines Reiterkriegers, bezeugt, wie früh sich das gegabelte Beinkleid gerade auf dem Rücken der Pferde als nützlich erwies. Von April an soll die Ur-Hose im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz zu besichtigen sein. Simone de Beauvoir ritt nicht – ein weiterer Grund für sie, Röcke vorzuziehen? Seit 2019 erweist ihr ein Berliner Mode-Startup die Ehre, das die Gründerinnen nach ihr Si Beau benannten. Die Kollektion des Unternehmens besteht aus Blazern, Kleidern, Röcken, in denen sich „Businessfrauen jeden Tag powerful, elegant und feminin fühlen können“. Jumpsuits und Hosen gehören allerdings auch dazu. ■
Aus der Gerücheküche
22. Februar Von der englischen Königin Elizabeth I. wird berichtet, sie habe unter allen Umständen auf Körperpflege Wert gelegt und sich gewaschen, „egal, ob es nottut oder nicht“. Sie tat es ein Mal im Monat. Einen Bruder im Geiste findet die berühmte frühneuzeitliche Monarchin in der Gegenwart: Nicht dass James Hamblin die Reinigung seines Körpers vollständig eingestellt hätte, doch Duschkabinen besteigt der 39-Jährige US-Amerikaner, früher Arzt, jetzt Journalist, seit 2016 nicht mehr. „Natürlich waschen!“ lautet seine Devise. Für einen Trend steht er, der sich in vielen Ländern längst mit Macht verstärkt und einen Namen hat: "No Bathing". Hamblin, als Beispiel vorangehend, entsagt jener Art von Pflegemitteln, mit denen die Kosmetikindustrie allein in Deutschland jährlich mehr als fünfzehn Milliarden Euro umsetzt (sofern ihr nicht gerade Corona das Geschäft verhagelt). Dem Mikrobiom auf der Haut, dem größten der Organe, nütze solcher Verzicht und ebenso der Umwelt, bestätigen seriöse Kollegen Hamblins, unabhängig Forschende und Hersteller von Naturprodukten. Aber jahrelang ohne Dusche … Deospray … Eau de Toilette …? Besagte britische Regentin ging unterm Ehrentitel einer „jungfräulichen Königin“ in die Geschichte ein, wobei sich andererseits Hinweise dafür finden, dass Elizabeth, wiewohl lebenslang unvermählt, gelegentlich doch einen Mann in ihr Schlafzimmer und zwischen ihre Laken einlud, unbesorgt um widrige Gerüche. Zu ihrer Zeit wie in den Jahrhunderten zuvor und danach waren die Menschen nicht allein im Ertragen von Kälte, Hunger und Schmerz weit härter gesotten als ihre Nachfahren heute, sondern ebenso in olfaktorischer Hinsicht, zumal beim lustvoll-leiblichen Umgang miteinander. Während die Römer des Imperiums ihrem Sauberkeits- und Entspannungsbedürfnis gewaltige Thermen errichteten, beharrten viele der antiken Frühchristen darauf, sich so zu erhalten, wie Gott sie geschaffen hatte, und lieber nicht durch Gebrauch von Ölen und Düften der todsündhaften Versuchung der Eitelkeit zu erliegen; allzu leicht, so lehrte man sie, dienten hygienische Kleider über reinlichen Körpern nur dazu, Flecken des inneren Menschen zu aufzuhübschen. Fast ausschließlich auf Duftwässerchen statt auf Wasser setzten die Reichen und Schönen der Renaissance und des Barock; den Architekten des Riesenschlosses in Versailles fiel nicht ein, in ihre Pläne auch nur ein Badezimmer, eine Toilette einzuzeichnen. Erst als das achtzehnte Jahrhundert aufs neunzehnte zusteuerte, kam es in Mode, Bäder „zu gebrauchen“, nicht zuletzt therapeutisch zur Kur, was etwa im Naturheilverfahren des „Wasserdoktors“ und Pfarrers Sebastian Kneipp gipfelte – ein empfehlenswertes, wenn auch im Ergebnis ungewisses, obendrein kaltes Vergnügen. Heute steht fest, dass jene Teile der Menschheit, die über frisches Wasser zum Trinken und Kochen wie auch zu ihrer Säuberung verfügen, vor vielen Seuchengefahren und Parasiten gefeit sind. Dem Schreiber dieser Zeilen, von trockenen und darum juckenden Hautpartien gequält, empfahl ein Dermatologe mürrisch, er solle eben nicht so oft baden und duschen: „Die Leute“, knurrte er, „waschen sich viel zu viel.“ Indes ahnt, wer in Stadtbussen oder Zugabteilen unterwegs ist, oft genug, dass jener medizinische Befund nicht immer der Wirklichkeit entspricht: Sobald einen ein Brodem aus Achseldünsten und Schwaden kalten Rauchs auf engem Raum umwabert, drängt sich der Verdacht auf, so mancher Zeitgenosse wasche sich nicht nur nicht „zu viel“, sondern wohl noch seltener als einst die Königin Elizabeth. ■
Materie des Lichts
19. Februar Die Dinge, die uns von Tag zu Tag am häufigsten begegnen, stacheln unsere Neugier am wenigsten auf und stecken doch, bei näherer Betrachtung, vielfach voller Wunder: die Luft zum Atmen oder der Erdboden, auf dem wir wandeln, das Wasser, das wir trinken und mit dem wir kochen, aber auch unseren Unrat fortspülen … Oder das Glas. Unsere steinzeitlichen Vorfahren sahen eine verblüffende Rarität darin, wenn sie Trümmer davon zwischen Steinen fanden: natürliches, seiner scharfen Splitterschneiden wegen nützliches Glas nämlich, Obsidian zum Beispiel, der entsteht, wenn etwa hohe vulkanische Hitze oder ein einschlagender Blitz Quarzsand geschmolzen hat. Heuer, 3500 Jahre nach den ersten belegten Verfahren zur Herstellung der so vertrauten wie staunenswerten Substanz, begehen die Vereinten Nationen das „Internationale Jahr des Glases“. Dabei verweisen sie auf die beispielhaft nachhaltige Verwendbarkeit des Materials, die sich beliebig oft zu hundert Prozent recyclen lässt, ohne Einbußen an seinen feststofflichen Qualitäten und seiner Klarheit zu erleiden. Letztere, die Transparenz, hat Glas schon vor Jahrhunderten unentbehrlich gemacht und verweist uns überdies auf seine besonderen symbolischen Implikationen. In durchsichtigen Glasflaschen bewahren wir Saft, Bier und Spirituosen, aber auch Schmerztropfen, Antibiotika und Hustenlöser auf. Aus unzähligen Weingläsern schimmert zivilisierter Menschheit das Rot oder Gold eines guten Tropfens entgegen. Durch die Flachglasscheiben unserer modernen Fenster dringt das Tageslicht hell in unsere Behausungen, während Kälte und Hitze, Wind und Regen draußen bleiben. In Mikroskopen und Teleskopen gewähren uns gläserne Linsen erste Blicke in den Mikro- und den Makrokosmos, und bevor Kunststoff-„Gläser“ jene aus echtem Glas ablösten, gaben Brillen uns den zuvor getrübten Durchblick in neuer Schärfe zurück. Gerade sie, die Augengläser, stehen zugleich für die zeichenhafte Bedeutung des Werkstoffs, die sich hinter seiner chemisch-physikalischen Körperlichkeit auftut. Durch Glas gelangt Licht in uns, indem dessen Energie die Glaskörper im Innern unserer Augen durchdringt, ohne Schaden in den empfindlichen Organen anzurichten. Im Glas, seinen prismatischen oder reflektierenden Eigenschaften, seinem Funkeln und farbensprühenden Glanz wird uns die Schönheit des schieren Lichts erst eigentlich offenbar. Von den bunten Lichtspielen mittelalterlicher Glasfenster las analphabetisches Kirchenvolk die Heilsgeschichten der Bibel ab. Ikonografisch gibt eine Kugel aus Kristall die vollendete Sphäre göttlichen Lichts wieder, während die Kirche angebliche Hellseher verdammt, wenn sie vorgaukeln, durch Glaskugeln in die Zukunft zu schauen. Einleuchtend gibt Glas seiner Zerbrechlichkeit wegen ein Inbild prompt eintretender, unumkehrbarer Vergänglichkeit ab, andererseits trösten sich abergläubische Optimisten damit, dass ausgerechnet Scherben Glück bringen. Seriösere Beobachter führt der Umstand, dass Glas die Dinge der Welt durchscheinen lässt, in Abgründe philosophischer Grübelei: Inwieweit sind die Objekte, die wir durch eine Scheibe sehen, noch wirklich und nicht nur mehr scheinbar sie selbst? Ist, epistemologisch betrachtet, das Glas in einer Tür, sobald wir es nicht wahrnehmen, ein Nichts – und erst dann ein Etwas, wenn wir, blind für das transparente Hindernis, dagegenlaufen und uns einen blutigen Kopf holen? Vor solchem Fehltritt bewahrt uns selbst das sonnenklarste Glasauge nicht. ■
Unsichtbare Kräfte
11. Februar Um Unsichtbares wahr- und ernst zu nehmen, brauchen die einen eine starke Vorstellungskraft, andere die Ehrfurcht der Spiritualität, die Dritten ein Mikroskop. Gelegentlich genügt sogar das unbewehrte Auge. Zu den ersten gehören die Schriftsteller, die allein durch Fantasie und Worte imaginäre Welten erschaffen. Gläubige mit genügend Gottvertrauen halten für ausgemacht, dass der Höchste aus seiner Verborgenheit heraus in die Alltagswelt hineinregiert. Den Naturwissenschaftlern, drittens, ist bewusst, dass das Auflösungsvermögen des Auges bei Strukturen versagt, die kleiner als ein Fünftel Millimeter sind. Zwischen Materialisten und Theologen vermittelte der Dramatiker George Bernard Shaw, indem er spöttelte: „Wenn ich an etwas glauben soll, das ich nicht sehe, so ziehe ich die Wunder den Bakterien vor.“ Ebenso gut hätte er die Magneten nennen können: Ohne irgendwelche Hilfsmittel lassen sie sich dabei beobachten, wie sie Metalle über mehr oder weniger weite Distanzen an sich ziehen und festhalten. Der Einsatz elektrischen Stroms vervielfacht die unsichtbare Wunderkraft; obendrein wächst sie exponentiell, fließt die Elektrizität durch Supraleiter, die bei tiefster Kälte dem Strom keinen Widerstand mehr entgegensetzen. Vor Kurzem ließ die berühmte Universität im kalifornischen Berkeley wissen, eine Arbeitsgruppe habe mit Atomen aus Seltenen Erden und des Elements Jod ein Molekül gebildet, das zu einer Anziehungskraft von der dreifachen Stärke der bis dato mächtigsten Magneten führe. Ein beeindruckender Rekord. Und welcher Magnet ist wohl der größte auf dem Planeten? Das steht schon seit wenigstens vier Jahrhunderten fest: Im Jahr 1600 veröffentlichte der englische Physiker William Gilbert sein Hauptwerk „Über den Magneten, magnetische Körper und den großen Magneten Erde“, worin er die These ausbreitete: „Magnus magnes ipse est globus terrestris“ – die Erdkugel selbst ist ein Magnet. Raumfahrer bestätigten: ihrer blauen Murmelgestalt wegen sogar ein besonders anschaulicher und schöner. Etwa anderthalb Jahrhunderte nach Gilberts Lehrsatz manifestierte sich indes die Idee einer ungesehenen Magnetkraft, die, wie es hieß, allem Stofflichen überlegen sei. Jenem „tierischen“ oder „animalischen Magnetismus“ setzte sich im achtzehnten Jahrhundert ein Visionär auf die Spur, der in sich den Erkenntniswillen des Naturkundlers, den Glauben des Mystikers und ein gerüttelt Maß Wunschträumerei vereinte: Franz Anton Mesmer hieß der 1815 mit 81 Jahren in Meersburg verstorbene Arzt. Erst sich, dann eine beträchtliche Schar von Adepten überzeugte er davon, er und andere einschlägig befähigte Wunderheiler brächten allein durch Berührung (meist durch die Hände) im Körper eines Patienten ein unsichtbares „Fluidum“ zum Rieseln; es lasse „die Ströme des Allgemein-Flüssigen durch die Nerven auf den innersten Organismus der Muskelfiber einfließen und [bestimme] ihre Verrichtungen“. „Mesmerisieren“, nach dem Begründer, hieß die Therapie , die konkurrierende Experten freilich früh als Scharlatanerie verwarfen. Inzwischen weiß man, dass nicht wundersame Einflussnahme den Heileffekt, wo er denn eintrat, auslöste, sondern Mesmers unbestreitbares Charisma. Seine Behandlungsmethode war der Hypnose verwandt. Die moderne medizinische Psychosomatik gründet unter anderem in seiner Einsicht, dass übers Wohl des Leibes auch der Geist obwaltet.■
Irische Odyssee
3. Februar James Joyce fand das Buch „verdammt lustig“. Er musste es wissen: hatte er es doch verfasst. Viele indes finden seinen „Ulysses“ furchterregend. Dabei wissen die meisten wenig davon: Sie lasen ihn nie. Gleichwohl steht bei vielen Literaturfreunden und -freundinnen, die auf sich halten, der Wälzer im Regal. Mit solchen umgangenen Lieblingswerken setzt sich Julius Deutschbauer auseinander: In Wien – und im Internet – sammelt der 61-jährige Performance- und Plakatkünstler eine „Bibliothek ungelesener Bücher“; im Verlauf von über siebenhundert Interviews mit Bibliomanen setzte sich der „Ulysses“ auf Rang zwei – Stand Herbst 2020 –, hinter Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“. Vor hundert Jahren, am 2. Februar 1922 und also am vierzigsten Geburtstag des Autors, erschien in Paris eine erste Ausgabe des „Jahrhundertbuchs“ und stieß von Anfang an als schwerer Brocken selbst hartgesottene Leser vor den Kopf: „Wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie nicht verstanden“, monierte etwa Kurt Tucholsky. „Was an diesem einen Tag, der [einer Verlagsmitteilung zufolge] dem Buch zugrunde liegt, vorgeht – ich habe das nicht gemerkt.“ Niemand also muss sich schämen, dem es nicht anders geht. Schon durch den Umfang bietet das unergründliche Werk Überdurchschnittliches: Knapp tausend Seiten umfasst es in Hans Wollschlägers gefeierter Übersetzung, vielfach brechen sich Stimmen und Stimmungen darin, unabsehbar verwirren sich Handlungsfäden zwischen kryptischen Bezügen und Symbolen, Sprachfetzen- und spielen, Bildsplittern und Situationsfragmenten. Mit „Rätseln, Anspielungen, absurden Denksportaufgaben“ füllte der irische Autor nach eigenem Bekunden sein Buch, in dem er achtzehn Stunden des 16. Juni 1904 Revue passieren lässt. Ehrfürchtig begehen Joyce-Adepten das Datum bis heute als „Bloomsday“. So nämlich, Bloom, heißt die wichtigste der drei Zentralfiguren: Anzeigenwerber Leopold Bloom durchstreift, zur selben Zeit wie Stephen Dedalus, ein Lehrer, die Straßen der irischen Hauptstadt Dublin. Zahllosen Menschen begegnet jeder für sich, bis ihre Wege sich kreuzen und sie sich gemeinsam betrinken. Wieder daheim fällt Bloom in tiefen Schlaf, im Bett neben der untreuen Gattin. Die, Molly, räsoniert abschließend über ihre Ehe und die Liebe abseits von ihr: acht Sätze auf 84 Seiten – ein grandioses Stück Prosa für sich. Indes scheint die Handlung sich insgeheim mit Alltäglichkeiten bescheiden zu wollen. Unter der Oberfläche aber errichtet sie ein Weltbild, das die Figuren und ihren Kosmos als Ganzes erfasst. Wie mit der Nadelspitze eines Seismografen zeichnet Joyces Feder den stream of consciousness nach, den Strom des Bewusstseins, eines Meers von endloser Weite, bodenlos tief. 2700 Jahre zuvor hatte der Erzdichter Homer den trojanischen Krieger Odysseus auf zehnjährige Seereise durchs Mittelmeer geschickt – auf seinen Abenteuern gründete Joyce die Struktur seines Buchs, der Experten seither hinterhertüfteln. Umso wirklicher breiten sich Dublins Grund- und Aufrisse aus: Das Bild der Kapitale um 1900, so versichern die Iren, lasse sich nur mit Hilfe des „Ulysses“ vollständig fassen. Wie durch die Hauptstadt führen auch durch den Roman zahllose labyrinthische Wege. Das hat er, ein Kerngestein der modernen Literatur, mit den Büchern gemein, die in Julius Deutschbauers Liste auf den Rängen drei und vier folgen: der Bibel und Marcel Prousts „Recherche“. Schwere Brocken auch dies. Doch das Lesen lohnt. ■
Mit Ausrufezeichen
29. Januar Manch ein Mann wird sich fragen: Welchem Kind wollte man solch eine Mama wünschen? In der Kunsthalle Mannheim ist, unter insgesamt 150 internationalen Arbeiten aus dem fünfzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart, die Fotografie einer (nicht mehr ganz) jungen Frau zu sehen, der man alles andere als mütterliche Gefühle zutraut. Der Blick kalt, hart der Mund; aus der Faust der linken Hand ragt steil der Mittelfinger, die Rechte hält Kopf und Pfoten eines Dackels. Die Arbeit der Finnin Elina Anneli Brotherus versteht sich so gründlich von selbst, dass es des Titels gar nicht bedürfte: „My Dog ist cuter than your ugly Baby“, „Mein Hund ist süßer als dein hässliches Baby“. Das Statement einer zeitgemäß selbstbewussten Künstlerin: Ihr ist klar, dass noch bis vor ganz kurzer Zeit die Ansicht vorherrschte, ‚Frausein‘ erfülle sich in der Mutterschaft. Unter den mancherlei Gründen für jene diskriminierende Einschätzung findet sich der unausweichlich biologische – Kinder werden nun einmal von Frauen geboren – und ein kirchengeschichtlicher: Der Katholizismus rückte die Maria des Neuen Testaments, die Gebärerin Jesu, als „Mutter Gottes“ auf einen der höchsten Ränge der Himmelshierarchie und proklamierte sie somit fast zweitausend Jahre lang als höchstes Vorbild für jedes Mädchen über vierzehn. Sie ist, so heißt es im uralten „Ave Maria“-Gebet, „gebenedeit unter den Frauen“, gesegnet also und gepriesen. Der Katalog der – leider schon am 6. Februar schließenden – Ausstellung zitiert die Künstlerin und Kunsthistorikerin Rachel Epp Buller mit dem Hinweis, dass bis weit ins vergangene Jahrhundert hinein westliche Darstellungen von Müttern sich zumeist der christlichen Ikonografie der Madonna mit dem Christuskind verdankten. So halfen die Bildnisse, Mütterlichkeit festzulegen als die angebliche Bereitschaft, bedingungslos zu lieben, alles zu verzeihen und sich entsagungsvoll aufzuopfern. Stimmte jene Definition, müsste der weibliche Charakter auf der fraglosen Unterordnung unter den Mann, das Kind (bestenfalls den Sohn) und die häuslichen Pflichten der Brutpflege gründen. Damit freilich geben sich nur die wenigsten Frauen zufrieden. „Mutter!“ heißt die Mannheimer Schau – in manchem Ohr mag der Titel zwar klingen, als jubelte da tatsächlich eine darüber, ihre naturgemäße Rolle endlich gefunden zu haben. Vielleicht aber ruft so ja auch ein Sohn, eine Tochter die widerborstige Mama zur Räson. Oder eine Frau, um ihre selbstbestimmte Zukunft bangend, seufzt im Kreißsaal entmutigt so und meint: Auch das noch! In dem Fall gehört das Ausrufezeichen erst recht zum Titel wie der Mittelfinger zu Brotherus‘ provokant eigenwilligem Selbstbildnis. In der Kunsthalle fehlt das ausgefallene Frauenporträt, mit dem Gustave Courbet 1866 zum „Ursprung der Welt“ vorstieß: Die lediglich einen Viertel Quadratmeter große Leinwand zeigt naturalistisch genau den nackten Schoß eines weiblichen Modells zwischen Busen und klaffenden Schenkeln. Bloß ein Wagstück aus der Geschichte der Pornografie? Gewiss, zugleich aber mehr als das; teilt das Gemälde dem Betrachter, der Betrachterin doch Grundsätzlichstes mit: Von hier bist du gekommen, so wie jeder und jede andere auch. „Mutter!“, mit dem unverzichtbaren Ruf-Symbol, kann hauptsächlich bedeuten: Wenn es uns Frauen nicht gäbe, die gebenedeite Spielart der Spezies Mensch, der alle Menschheit das Leben verdankt. ■
Tiefe Einsicht
22. Januar Wie viel auch immer wir mit den Tieren gemeinsam haben, dies immerhin ist allein uns eigen: Von unseren entwicklungsgeschichtlichen Anfängen an schauen wir Menschen in den Himmel und sind fasziniert von ihm. Zunächst, und jahrtausendelang, sprachen unsere Vorfahren der Erde irrtümlich den höchsten Rang eines kosmischen Zentrums zu. Spätestens seit etwa fünfhundert Jahren staunen wir darüber, dass unser Planet, im Gegenteil, kaum ein Staubkorn in der unendlichen Schöpfung ausmacht und doch so etwas Tolles wie den homo sapiens hervorbrachte mitsamt der vielleicht komplexesten Struktur des Universums, unserem Gehirn, im Kopf. Tiere, heißt es, könnten von sich kein Bild in die Zukunft entwerfen. Das bleibt uns vorbehalten – erst recht das plausible Bild unseres Gewordenseins, das wir 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückprojizieren. Jene einzigartige Gedankenleistung erinnert uns an die Nähe, die zwischen der Geschichte der Kultur und jener der Naturwissenschaften seit jeher besteht. Vor wenigen Tagen gelang es der Nasa, den zusammengefalteten Hauptspiegel des am ersten Weihnachtsfeiertag gestarteten „James Webb“-Teleskops vollständig auszubreiten; so versetzte die Raumfahrtbehörde es in die Lage, günstigenfalls zwanzig Jahre lang so weit wie noch kein Beobachtungsinstrument zuvor in die Tiefen des Alls zu blicken: bis in einen Zeitraum nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall. Derweil ging vor unseren unbewehrten Augen ein Himmelsereignis vonstatten, das die Menschen lange missverstanden: Während der vergangenen Monate stand die Venus nach Sonnenuntergang am Firmament; seit zwei Wochen ist sie indes frühmorgends überm Horizont zu sehen: Aus dem Abend- wurde der Morgenstern. Sternguckern früherer Epochen erblickten in unserem Nachbarplaneten denn auch lange zwei unterschiedliche Himmelskörper, beide der Verehrung würdig. Überhaupt galt über Äonen hinweg der Himmel den Menschen allerorten nicht nur als Interessenssphäre wissenschaftlicher Erkundung, erst recht nicht als touristisches Wunschziel, das heutzutage raumfahrtaffine Multimilliardäre bei Kurztrips ansteuern. In der Vorstellung der Alten spannten sich sphärenmusikalische Schalen ausladend über die bewohnbare Welt, im Gewölbe wohnten Göttinnen und Götter, aus ihm drangen unbegreiflich und unbeherrschbar magische Kräfte, an ihm prangte, als dominanter Solitär, der den Messias bezeugende Stern von Bethlehem … Nur scheinbar ein paar Nummern kleiner setzte Caspar David Friedrich den kosmischen Fernblick in Szene: Noch bis zum 6. Februar zeigt das Dresdner Albertinum in seiner Ausstellung „Träume von Freiheit“ (über russische und deutsche Malerei der Romantik) Friedrichs berühmte „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“. Auf der gut zweihundert Jahre alten Leinwand sind ein älterer und ein jüngerer Herr unter einem Baum dargestellt, von der schmale Mondsichel, einem Christussymbol, in den Bann geschlagen. Rechts daneben: ein Leuchtpunkt – die Venus als Lebensabendstern. Kleinlich kritteln Besserwisser, sie müsse, gemessen an der Entstehungszeit des Bildes, links vom Mond stehen. Indes brauchen sich Künstler den Geboten astronomischer Genauigkeit nicht blind zu unterwerfen. Von den raumzeitlichen Panoramen, die „James Webb“ bald liefert, verlangen wir sie schon. ■
Chip mit Grütze
8. Januar Wenn die Älteren und Alten unter uns vor fünfzig Jahren „Pong“ lernen wollten, mussten sie sich nicht arg anstrengen. Den kurzen Namen trug das Spiel, weil es uns sozusagen höchstens halb so schwer fiel wie Pingpong, das dreidimensionale Tischtennis mit richtigem Ball und echten Schlägern. Ein „Pong“-Turnier hingegen wurde als Videospiel – des US-Herstellers Atari – ausgetragen, auf einem flachen, dunklen Bildschirm, den ein Lichtpunkt durchquerte, damit wir ihn mittels senkrechter Strichlein links und rechts abfingen und zurückschickten. Im Vergleich zu heutigen games nahm eine Partie nur Kleinstmengen unseres Hirnschmalzes in Anspruch: Etwa eine Million Neuronen genügten dafür, gerade mal ein Hunderttausendstel der Zellen in unserem Zerebrum. Herausgefunden haben dies jetzt Tüftlerinnen und Tüftler in Australien, die erforschen, wie sich technische Hardware und elektrophysikalische Vorgänge mit den Fähigkeiten unseres organischen Gripses verknüpfen lassen: Weltweit berichteten unlängst Medien (wie hierzulande der Focus), die Startup Cortical Labs seien einem biologischen Prozessor auf der Spur. Sehr vereinfacht gesagt, züchtete das Team auf dem Elektrodengewebe einer Platine eine kleine Gewebemenge aus Stammzellen des menschlichen Gehirns, setzte jene wet ware – nasse Sache – speziellen elektromagnetischen Signalen aus und registrierte antwortende Impulse aus dem Mikrochip. Und siehe da: Binnen fünf Minuten gelangte der Zellhaufen an ein Ziel, an dem eine zweckgleich eingesetzte Künstliche Intelligenz (KI) erst nach einer Stunde ankam – er konnte „Pong“ spielen. Mit solch spektakulären Experimenten einer biologisch basierten Informatik, wie sie auch in den Vereinigten Staaten und Europa unternommen werden, scheint ein Weg beschritten, der die KI weit hinausführt aus der Gebundenheit an Einsen und Nullen, hin zu Talenten, die vor Kurzem noch unserer naturgewollten Grütze vorbehalten schienen: zu freien Assoziationen, Geistesblitzen und Gedankensprüngen, Zukunftsplanung, Kreativität, den Fiktionen der Kunst … Wann spielt ein Computer? Bislang nur dann, wenn menschlicher Verstand ihn zu spielen heißt. Wie spielt er? Mit unmenschlicher Rechenleistung und widernatürlicher Geschwindigkeit. Bereits zum 25. Mal jährte sich 2021 der Tag, an dem ein Elektronengehirn erstmals gegen einen amtierenden Schachweltmeister triumphierte: Das Superhirn „Deep Blue“ von IBM bezwang 1996 Garri Kasparow in zwei von sechs Partien, indem es zweihundert Millionen mögliche Züge pro Sekunde durchrechnete; im Jahr darauf entschied es ein ganzes Turnier gegen den Russen für sich. Auch in Dame und Backgammon erweist sich KI dem humanen Köpfchen längst als überlegen. 2016 schließlich zwang sie eine Koryphäe des 2500 Jahre alten Brettspiels Go aus China in die Knie. Spiel, das deutsche Wort, kann viel bedeuten. Kleine Kinder spielen meist ungehindert, spontan und planlos. Andere Spiele folgen festen Regeln, deren Eindeutigkeit Computern einleuchtet. Zugleich verfolgt das Spiel an sich keine Zwecke außerhalb seiner selbst. Werden aber die auf Einsen und Nullen abonnierten Schaltkreise so viel Freiheit verkraften? Für fast jedes Spiel trifft zu, was Loriot in einem seiner Sketche ironisch darüber sagen lässt: Es ist „etwas Heiteres, es soll Freude machen“. Werden folglich digitale Endgeräte demnächst über Siege jubeln? Wird, während einer Arbeitspause, unser Laptop kraft eigener Entscheidung Bitcoins bei einem Glücksspiel setzen? Dürfen wir dem PC genug Charakter zutrauen, uns nicht zu verspotten, wenn wir unterliegen? Und wie sieht das Fäustchen aus, in das der Computer sich lacht? ■
Was wir brauchen
4. Januar Auf das Wenigsten von dem, womit wir unser Leben ausstaffieren, wollen wir verzichten. Aber das meiste davon brauchen wir nicht: „nicht wirklich“, wie man so sagt – nicht, um zu überleben. Wer mag, darf alles für überzähligen Luxus halten, was über das hinausgeht, was Abraham Maslow als unerlässliche Bedingungen für unsere biologische und soziale Existenz definierte: In seine „Bedürfnispyramide“ trug er zuallererst die Luft zum Atmen, ausreichend Flüssigkeit und Nahrungsmittel sowie eine Behausung ein, die uns vor den Unbilden von Natur und Wetter abschirmt; darüber schichtete der US-amerikanische Psychologe den Schutz vor den mancherlei Arten von Gewalt und Unsicherheit, geordnete und stabile soziale Verhältnisse, einen unangefochtenen, anerkannten Platz in ihnen, Freiraum zur individuellen Sinngebung und dergleichen. Um all das zu erlangen, wohnt jedem von uns ein natürliches Streben inne. Wo dieses Verlangen indes den Rahmen fairer Mitmenschlichkeit überschreitet, entartet es zur Gier. Sobald wir besagte Grundbedürfnisse schmerzlich als unerfüllt empfinden, wächst in uns die Bereitschaft, sie mit gesteigerter Selbstsucht zu befriedigen, die womöglich in Gewalt und Hass ausufern. In drei Ausstellungen zum Thema ermittelt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart „Was uns bewegt“: Bis zum vergangenen September widmete es sich der „Gier“; zurzeit, bis zum 24. Juli, spürt sie dem „Hass“ nach. Versteht sich, dass der Blick dabei auf internationale Spannungen und ihre Entladungen fällt, so auf die Französische Revolution, die unzählige Aristokraten und tatsächliche oder vermeintliche Konterrevolutionäre die Köpfe kostete und in eine ganze Reihe grausiger Kriege mündete. Den Hass gegen Juden und Minderheiten rückt das Kuratorenteam ins Bild, politische Aktionen gegen Einzelne – wie das Attentat auf den weiland preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, durch das der Mannheimer Ferdinand Cohen-Blind 1866 den „Deutschen Krieg“ gegen Österreich verhindern wollte -, nicht zuletzt die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen und Kinder. Seit der Verbreitung des Internets stehen den unversöhnlichsten Spinnefeinden unter uns zahllose Hass-Foren von buchstäblich unerschöpflichem Fassungsvermögen und grenzenlosem Verbreitungsgebiet zur Verfügung. Als Wurzeln und Motive macht die Präsentation – neben unser aller Neigung, etwas geringzuschätzen, das nicht unseren persönlichen Festlegungen entspricht – die verbreitete Angst vor dem Anderen und Fremden aus und den Neid auf jene, die es vorgeblich schöner oder besser haben. Was dagegen hilft, sind – zum Beispiel jetzt, zum neuen Jahr – die berühmten „guten Vorsätze“, sofern sie realisierbar bleiben: Zu Toleranz, Anteilnahme, gegenseitigem Sich-gelten-Lassen sollte es wohl reichen. Man kann, gerade anderthalb Wochen nach Weihnachten, dazu auch „Liebe“ sagen: Auch sie brauchen wir wie Nahrung und Wohnung, wie die Luft zum Atmen. Ihr wird folgerichtig die dritte Stuttgarter Schau gewidmet sein, die ab dem 14. Oktober die Trilogie abschließen soll. Unseren Planeten be- und übervölkern beinah acht Milliarden Menschen, denen die Nachrichten Tag für Tag viel Schlechtes nachsagen. Gleichwohl sollten wir uns, gerade mit dem Rück-Blick auf das Jesus-Baby in der weihnachtlichen Krippe, bewusst machen: Fast jeder von ihnen wurde als Kind der Liebe empfangen. ■