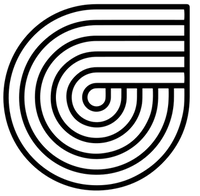Eckpunkte-Archiv 2020/21
Viraler Christbaum
24. Dezember Corona heißt Krone, und unserem jährlichen Festkalender setzt Weihnachten die Krone auf. Als wir uns am Heiligen Abend 2020, nach immerhin schon acht Covid-gebeutelten Monaten, unter unseren Lichterbäumen versammelten, wünschten wir uns nicht bloß das übliche „frohe Fest“, wir wagten auch noch, an eine bessere Zukunft zu glauben: Grämt euch nicht, sprachen wir einander zu, nächstes Mal wird alles wieder anders, nämlich so wie immer sein. Wie falsch wir doch lagen! Noch weit mehr als damals lastet der Schatten der Corona-Pandemie diesmal überm Fest der Feste, und wer von uns seinen Nächsten das gängige „gesunde neue Jahr“ zuruft, gerät leicht in Zynismus-Verdacht: Gesund? Wo die fünfte Welle geradezu als „Wand“ auf uns zukommt, wie die Epidemiologen prophezeien? Gleichwohl stellen sich in unseren Alltagsroutinen längst Prozesse der Gewöhnung ein. Die zeigen sich zum einen, wie bei vergleichbaren Gelegenheiten stets, durch spezifische Bereicherungen unserer Sprache: Zeitgenossen, denen wir bislang kaum zutrauten, die Schlagzeilen ihrer Tageszeitung zu verstehen, hören wir nun lippenflink von „Inzidenz“ und „Inkubation“, „Booster“ und „B.1.617-Mutante“, „Systemrelevanz“ oder „Weihnachtslockdown“ parlieren. Zum andern greift unsere Ikonografie auf Muster aus, die sich der Formenwelt der Seuche verdanken. Namentlich bietet sich da die einprägsam symmetrische Kugelgestalt des Virus Sars-CoV-2 an. Mag sein, dass sich Spaßbremsen und Miesepeter von ihr an die fatale Ästhetik jener Seeminen erinnert fühlen, die wie stählerne Ballons mit igelstachelig herausragenden Zündern während der Weltkriege die Meere unsicher machten. Weitaus lieber aber denkt das Gros von uns adventlich gestimmt an jene mit regelmäßigen Nelkenmustern gespickten Duftorangen, die, auf die Heizung gelegt, ein typisch weihnachtliches Aroma durch alle Zimmer verbreiten. Was liegt näher, als dass wir den anmutigen, indes nur achtzig bis 140 millionstel Millimeter winzigen Keim – kugelförmige Hülle mit Protein-Auswüchsen in Bäumchengestalt – riesenhaft vergrößert als Festschmuck an unsere Christtannen binden. Einschlägige Ladengeschäfte und der Versandhandel halten solcherart Corona-Baumkugeln in mancherlei Formaten und unterschiedlicher Farbgebung feil, wobei der vergleichsweise hohe Preis – etwa dreizehn bis achtzehn Euro pro Stück – ahnen lässt, was die Pandemie die Volkswirtschaften überall auf Erden bisher schon gekostet hat und noch kosten wird. Desgleichen vertreibt die Branche, um nur ein paar Beispiele zu nennen, klitzekleine Gesichtsmasken, Lebkuchenmännchen und fassungslos blickende Weihnachtsmänner mit Mundnasenschutz, Impfdosen-Ampullen („Team Moderna“) oder Mini-Klopapierrollen als Anhängsel für die kerzenstrahlenden Zweige. Zwar wenden traditionsbewusste Pressekommentatoren ein, dass solch „kurzlebige Trends auf dem Baum nichts zu suchen“ hätten. Wenigstens aber darf heuer niemand behaupten, Weihnachten als Fest sei aus der Zeit gefallen. Ein „Ornament aus mitteldichter Holzfaserplatte in Benelux-Form, mit permanenten Sublimationstinten bedruckt und einem Band zum Aufhängen“ (17,06 Euro) jubelt im pastellfarbenen Plätzchen-, Zimt- und Tannenzweig-Design: „Holly Shit – we survived 2021“. Vom Christkind wünschen wir uns als Geschenk, dass wir Ähnliches auch 2022 sagen können. ■
Helden- und Hildensage
9. Dezember Mythische Gestalten, Superhelden, archetypische Märchencharaktere reiht die Fernsehdoku-Serie „Terra X“ derzeit scharenweise vor uns Fernsehschauern auf: Noah schippert auf seiner Arche über die Wellenkämme der Sintflut, König Artus castet seine Tafelrunde, der Ithaker Odysseus zuckelt im hölzernen Pferd durch Trojas Stadttor, Doktor Frankenstein schustert sein Monster zusammen, der skandinavische Gaute Beowulf zeigt Hänsel, Gretel und Frau Holle, wo der Hammer hängt … Für sehr aufgeklärt halten wir uns und hören sie doch gern, die „alten mæren“, Sagen und Historien, die wohlig an schlummernde Urängste in unseren Stammhirnen rühren, heimliche Sehnsüchte nach Ruhm und Reichtum wachkitzeln – und dabei spannend und verklausulierend das humanum selbst, die elementaren, vor- und überzeitlichen Wesenszüge unseres Menschseins, bebildern. Geht es nicht in (fast) allen erfundenen Geschichten, die wir von alters her erzählen, ganz so wie im echten Leben letztlich nur um zweierlei: um Liebe und Macht? Ein Großteil aller Fantasy-Stoffe spross aus diesen saftigen Wurzeln, und verlässlich versorgen sie weiterhin die Autoren des Unterhaltungsfilms und der trivialen Belletristik, die Schöpferinnen und Schöpfer des großen Kinos und der Hochliteratur. Erst vor wenigen Wochen ging der Urmythos von uns Deutschen, das Nibelungenlied, in einen neuen Roman ein: Felicitas Hoppe, Büchnerpreisträgerin des Jahres 2012, deutet in „Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“ die Überlieferung beherzt neu und um. Zugleich wird für die Nibelungen-Festspiele in Worms, die auf dem Domplatz die Sage in Freilufttheater ummünzen und im Sommer zwanzig Jahre alt werden, ein einschlägiges „Königinnendrama“ von Ferdinand Schmalz mit dem Titel „Hildensaga“ angekündigt. In der „Terra X“-Reihe „Große Mythen aufgedeckt“ wollen Alexander Hogh und Saskia Weisheit am Sonntag um 19.30 Uhr herausstellen, dass es sich bei dem unverweslichen Nationalepos, wenngleich es vordergründig dem grandios scheiternden blonden Drachentöter Siegfried ein Heldenlied singt, im Grunde um den „ersten deutschen Frauenroman des Mittelalters“ handle. Da mag was dran sein, spielen doch in den meisten Be- und Verarbeitungen, auch im musikdramatischen „Ring des Nibelungen“ Richard Wagners, Siegfrieds Gemahlin und Witwe Kriemhild oder andere Damen eine entscheidende, wenn nicht die tragende Rolle; während des feuerflammenden Untergangs, den der „Meister von Bayreuth“ der Opernwelt seines Vierteilers am Ende bereitet, behält die wuchtige Brünnhilde das unwidersprechlich letzte Wort - bis das Leitmotiv der zarten Sieglinde die monumentale Musik dann doch mit einer Ahnung von Trost und Zukunft beschließt. Für die beiden existenziellen Konstanten Macht und Liebe fand der dichtende Komponist das vollendete Symbol: den titelgebenden Ring, der grenzenlose Autorität durch uferlosen Besitz verleiht, freilich nur dem, der bereit ist, jeder Herzensneigung zu entsagen. Dergleichen fällt, im Mythos wie in der Wirklichkeit, den meisten Männern leichter als den Frauen; was Letztere jedem, der über Hirn und Herz verfügt, viel interessanter macht als die in Drachen- und Menschenblut badenden Recken und Haudraufs. So beginnt zwar auch in der „Terra X“-Doku das Nibelungenlied mit den vielzitiert-grandiosen Versen „Uns ist in alten mæren wunders vil geseit / von helden lobebæren, von grôzer arebeit …“ Doch kommt eine Handschrift aus dem sechzehnten Jahrhundert ins Bild, die das Epos vielsagend anders überschreibt: „Dietz Puech heysset Chrimhilt“. ■
Urmomente
27. November Vor sehr, sehr langer Zeit war es unseren vormenschlichen Ururahnen egal, ob sie Geräusche oder Töne erzeugten. Hauptsache, sie hörten was. Die ersten Laute, die ungeschliffen aus ihren Kehlen drangen, dienten nicht dem traulichen Gespräch, nicht dem Erzählen von Erlebnissen oder gar Mythen – es handelte sich, wie Paläoanthropologen herausfanden, um Signale des Alarms, die vor Gefahren warnten, und um Hinweise, etwa die Richtung betreffend, wo Wasser, Nahrung, ein sicherer Schlafplatz zu finden sei. Wenn dergleichen Mischwesen – schon nicht mehr Affen, noch lange keine Menschen – zu diesem Zweck nicht grunzten, knurrten, kreischten, so schlugen sie Gegenstände aneinander, Stein auf Stein, Holz auf Holz: Sie trommelten. Irgendwann wurden sie gewahr, dass derlei Lärm von Fall zu Fall als Wohllaut in ihre haarigen Ohren drang, und so mag in ihnen eine erste Ahnung gewachsen sein von den vielversprechenden Unterschieden zwischen bloßem Krach und feinerem Klang. Als älteste erhaltene Musikinstrumente nennt die Fachwissenschaft zwar Flöten: Eine trat 1995 in einer slowenischen Höhle zutage, wurde aus dem Oberschenkelknochen eines jungen Bären geschnitzt und soll 50.000 Jahre alt sein; eine andere, ursprünglich der Flügelknochen eines Gänsegeiers, entdeckten Tübinger Ur- und Frühgeschichtler 2008 nicht weit von Ulm und schätzten ihr Alter auf über 35.000 Jahre. Solche Artefakte aber entstanden bereits durch die geschickten Hände des homo sapiens. Das Trommeln indes war vermutlich schon Aberhunderttausende Jahre vor dessen erstem Auftreten, und noch vor einem einigermaßen melodiösen Gesang, die erste Art unserer Vorvorfahren, so etwas wie Musik zu erzeugen; gut möglich, dass sie Eingang in Rituale der Jagd fand, noch bevor sich spirituelle Kulte entfalteten; kaum zweifelhaft, dass sie in engem Zusammenhang mit dem Tanz entstand. Seither haben Schlagwerke immer mannigfaltigerer Art weltweit alle Epochen der Kulturentwicklung und Zivilisationsgeschichte begleitet. Mithin ist es wahrlich an der Zeit, dass zum ersten Mal überhaupt ein Schlaginstrument zum „Instrument des Jahres“ erhoben wird: Die Landesmusikräte in der Bundesrepublik vergaben am Donnerstag den Titel für 2022 an das Drumset, das, Trommeln und Becken vereinend, im Jazz, Rock und Pop unverzichtbar ist und in der einen oder anderen Form auch in der Neuen Musik der ‚klassischen‘ Sparte hier und da mitspielt. Mit der für 2021 gekürten Orgel hätten die Räte noch ein Spezialpublikum angesprochen, räumte Hermann Wilske, Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg, ein. Nun stimmen Volkes Stimme und speziell die Jugend der Entscheidung womöglich freudiger zu: „Das Drumset“, sagt Wilske, „zählt deutschlandweit zu den fünf meistgespielten Instrumenten in den Musikschulen.“ Dass rhythmischer Trommelklang sowohl kleine Kinder magisch anzieht als auch alte Menschen aufhorchen lässt, mag an seiner Ähnlichkeit mit dem Herzschlag der Mutter liegen, den wir schon vor der Geburt pausenlos vernahmen und archaisch mit Geborgenheit assoziieren. Selbst die Herren Lennon, McCartney und Harrison führten die Gründung ihrer Band nicht eigentlich auf ihre Stimmen oder auf Gitarre, Bass und Keyboard zurück: „Als Ringo Starr bei uns erstmals an den Drums vorspielte“, erinnerte sich Paul McCartney, „stand fest: Dieser Moment ist der Beginn der Beatles.“ ■
Zweierlei Marien
23. November Seit jeher wissen Päpste ganz genau, wie der unergründliche Heilsplan Gottes im Einzelnen aussieht, was Jesus, sein Sohn, gewollt hat und wie Maria, dessen Mutter, denn so dachte. Woher die Pontifices ihre Himmelskenntnis nehmen, ist nicht recht erfindlich. Gleichwohl erlaubt es die globale Machtposition den zölibatären Patriarchen, ungeachtet weltfern überalterter Hierarchien rund um den Heiligen Stuhl und eines grotesk verzerrten Geschlechterbildes Frauen in ihre Schranken zu weisen, als wären sie eine Minderheit. Dabei stellen sie hierzulande 53 Prozent der Katholiken. Gelegentlich wird ein beschwichtigendes Zeichen gesetzt: So durfte im Mai dieses Jahres mit Dr. Carmen Breuckmann-Giertz eine Theologin sogar zur Chefin der Priesterausbildung im Erzbistum Köln aufrücken. Ob das dem Ex-Papst Joseph Ratzinger behagt? Der warf den Frauen 2004 ein „Streben nach Macht“ vor, das zu einer „Rivalität der Geschlechter“ führe, mit „unmittelbarster und unheilvollster Auswirkung in der Struktur der Familie“. Die aber hat heilig zu bleiben und die Frau sich damit zu bescheiden, in ihr zu „dienen“, ganz nach dem – angeblichen – Vorbild Marias. Ratzingers Vorgänger Johannes Paul II. lehrte denn auch, Jesu Mama habe „ihre bevorzugte, aber alles andere als leichte Berufung einer Braut und Mutter der Familie von Nazareth aus Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes angenommen“. Da dürfte es doch auch heute den Hausfrauen kaum schwerfallen, „einen gewissen Rollenunterschied anzunehmen“. Nicht viel anders sieht es jetzt, ein gutes Vierteljahrhundert später, Papst Franziskus: „Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche, indem sie die Kraft und die Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben.“ Dass man darüber auch anders denken kann, zeigt sich nicht erst seit gestern: Schon 1976, und fortan immer wieder, wurde in der katholischen Kirche laut über die Frauenordination diskutiert. „Der Schöpfergott“, meinte 2019 etwa die emeritierte Münsteraner Theologie-Professorin Marie-Theres Wacker, „hat den Frauen ihre Talente sicher nicht gegeben, damit sie in verengten Rollenmustern verkümmern.“ Auch so manche frühen Christinnen und Christen dachten wohl so, wofür Archäologen in Südisrael gerade eben Belege fanden: In der vergangenen Woche meldeten sie, bei der Hafenstadt Aschdod in den Resten einer gut 1500 Jahre alten Basilika auf Gräber mit Inschriften gestoßen zu sein, denen zufolge dort auch Frauen als Geistliche und Diakonissinnen tätig waren, ohne Rangunterschied zu ihren männlichen Kollegen. Weil aber diese Ämter an eine Weihe gebunden sind, behält die katholische Kirche sie seit Jahrhunderten Männern vor, bis heute. In der vorvergangenen Woche schickten die Aktivistinnen von „Maria 2.0“ nicht weniger als 20.000 Postkarten mit klar definierten Reformwünschen an den „lieben Papst Franziskus“, unter anderem mit der Forderung, den „Frauen die ihnen von Gott gegebenen priesterlichen Berufungen in der römisch-katholischen Kirche nicht länger zu verwehren und sie an der kirchlichen Macht und am Weiheamt teilhaben zu lassen“. Zu „Maria 2.0“ hätte Maria Rüb wahrscheinlich nicht gehört: Mit „schlohweißem, kurzem Haar, einem Lächeln auf den Lippen und zwei hellwach strahlenden Augen hinter den Brillengläsern“, wie der Bayerische Rundfunk meldete, führte sie ihrem Adoptivsohn Peter, einem Priester im unterfränkischen Poppenlauer, den Haushalt, bis kurz vor ihrem Tod unverdrossen „dienend“. Sie brauchte nicht mehr umzudenken: Sie wurde 101 Jahre alt. ■
Eins mit Stern
13. November Als ihm das Ende nahte, fand er erst alles wie erwartet – und staunte dann nicht schlecht. Einem Priester aus Massachusetts wurde 2015 ein Nahtoderlebnis zuteil, so wie zahllose einschlägige Erfahrungsberichte es tröstlich kolportieren: Zunächst fühlte sich der 71-Jährige eingehüllt in ungekannte Helligkeit und von grenzenloser Liebe. Anschließend aber trat Gott persönlich auf ihn zu – und offenbarte sich als Frau. Gott: eine Göttin? Zumindest ein „feminine, mother-like being of light“, ein weibliches Wesen des Lichts nach Art einer Mutter, wie der Gottesmann, nach 48 Minuten klinischen Todes, über Facebook überwältigt in die Welt posaunte. Herausfordernd „Frau Gott“ hieß fünf Jahre später das Debüt-Album der Hamburger Indie-Rock-Band Trixsi; zwar waren die elf Songs unabhängig von der Jenseitsschau des US-Geistlichen entstanden, der Titel der CD indes verweist auf ein Problem, das die katholische wie die evangelische Kirche seit Längerem plagt. Malen sich nicht viele Zeitgenossen – wie auch, als Kind, der Schreiber dieser Zeilen – den „lieben Gott“ so aus, wie Leonardo da Vinci in einer berühmten Rötel-Zeichnung von 1512 (vielleicht) sich selbst darstellte: als uralten Mann mit langem, vermutlich weißem Haar, ebensolchem Rauschebart und buschigen Brauen, weit weniger Liebe als grämliche Strenge um Augen und Mund? Andererseits tummeln sich in den Religionen der alten Griechen und Römer, ebenso wie in vielen anderen früheren und lebendigen, Göttinnen zuhauf. Im antiken Hellas, nur als Beispiel, hielt Hera als Gattin des Gottvaters Zeus und Schützerin der Ehe eine Führungsposition; desgleichen stand Athene, Schutzgöttin der Hauptstadt sowie grande dame der Weisheit, des Handwerks und des Kriegs, mit an der Spitze des olympischen Kollegiums. Ganz anders spekulieren Juden, Christen, Moslems: In ihren transzendenten Sphären herrscht das Patriarchat. Wenigstens leisten sich die Katholiken mit Maria, der Mutter Jesu, eine Quotenfrau. Doch das soll nun nicht mehr genügen. Bei der Bundeskonferenz der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) im Frühling nächsten Jahres könnte die Männlichkeit des „Herrn“, „Herrschers“ und „Vaters im Himmel“ relativiert werden: Denn die Organisation, der etwa 80.000 Gläubige zwischen neun und 25 Jahren angehören, stellte unlängst die zeitgemäße Grundfrage: „Was können wir tun, um das an vielen Stellen sehr männlich geprägte Gottesbild in die Vielfalt zurückzubringen, die es verdient?“ Soll heißen: Wie die Nummer eins im Himmel – ob Gott oder Göttin – als Wesen mit beider- oder mehrerlei oder mit keinem Geschlecht kennzeichnen? Als Vorschläge diskutiert werden derzeit vor allem ein angehängtes Sternchen oder, durch Kreuzform besonders adäquat, ein Pluszeichen: „Gott*“ oder „Gott+“. „Wir wollen“, bekräftigt Rebekka Biesenbach, Geistliche Bundesleiterin der KjG, „auf jeden Fall etwas ändern“. In der Nachbar-Fakultät findet sie Unterstützung: Das „Sternchen auch im Gottesnamen“ nennt Irene Diller von der Gender- und Gleichstellungsstelle der rheinischen Kirche „eine heilsame Irritation“. Im Protestantismus sei es schon durchaus üblich. „Die Bibel selbst kennt ganz viele Bilder für Gott, und die sind nicht nur männlich.“ Müssen sich fromme Christen also umgewöhnen? Vielleicht fällt das ja gar nicht so schwer. Der Werbetext zum Trixsi-Album jedenfalls verspricht: „ ‚Frau Gott‘ macht glücklich.“ ■
Aktivisten des Lichts
26. Oktober „Lux – Krieger des Lichts“ hieß vor vier Jahren einer der unerwarteten Lieblingsfilme des Hofer Filmtage-Publikums. In der famos bitteren Satire des Mainzer Regisseurs Daniel Wild klettert ein einzelgängerischer Loser in ein Superhelden-Kostüm Marke Eigenbau und streift durch die Kieze der Berliner Nacht; auf seine Weise will er die verkehrte Welt besser machen. Aber Lux, das kleine Licht, fällt auf: Ein Fernsehteam putscht sein „Weltpolizei-Ding“ zur großen Show hoch, manipuliert ihn erst und demontiert ihn schließlich. Erschiene der underdog in diesem Oktober abermals auf den Hofer Leinwänden, er gäbe eine Allegorie fürs Kino und für die 55. Internationalen Filmtage ab, die am heutigen Dienstag an den Start gehen. Die Corona-Pandemie drehte, wie der öffentlichen Kultur allgemein, auch den Filmtheatern das Licht aus; glücklicherweise mussten bisher weniger schließen, als anfangs zu befürchten stand. Auch teilt die Branche mit, nicht wenige, die sich während der Pandemie-Wellen ans Angebot der Streaming-Dienste gewöhnt und es sich daheim damit gemütlich gemacht haben, kehrten nun gern in die öffentlichen Schauräume zurück. Eine verkehrte Welt rückt sich gerade. Zu verdanken ist das nicht zuletzt den hartnäckigen Kämpfern in vielen bundesrepublikanischen, auch in den Hofer Häusern: Ein gutes - schlimmes - Jahr lang setzten sie alles daran, den Kopf über Wasser zu halten, das ihnen bis zum Hals stand. In den wieder geöffneten Lichtspielhäusern scheint der Neustart gelungen, aber das Weitermachen fällt nicht leicht. Nur mit Gesundheitsnachweis darf Publikum die Säle besetzen, muss aber keine Masken mehr tragen. Das neue, ansehnliche „James Bond“-Abenteuer als dringlich erwarteter Blockbuster scheint vorsichtige Hoffnungen auf ein durchschlagendes Comeback des Kinos zu erfüllen; freilich wird ein solcher Renner allein nicht reichen. Durchhaltevermögen war und bleibt von Regisseuren und Darstellerinnen, Verleihern wie Kinobetreiberinnen gefragt; eindrucksvoll bewies und beweist die Branche es, auch das Hofer Festival. Selbst unter zuvor ungekannt widrigen Bedingungen ließ das Team um Thorsten Schaumann im Herbst 2020 die 54. Filmtage stattfinden, ungeachtet des finanziellen Risikos und, zugegeben, bei teilweisem Verzicht auf jene Aura einer familiären Unaufgeregtheit, die an der Saale bekanntermaßen einzigartig ist. Heuer, bei wieder steigenden Inzidenzen, aber fallenden Hygieneregeln, will das Filmfest auch atmosphärisch wieder an die Vor-Corona-Jahre anschließen. Abermals hybrid – also zugleich mit Präsenz-Vorführungen und Online-Angebot – wirds weitergehen; die Mischform konnte im vergangenen Jahr überzeugen. Zu den vielen Auszeichnungen, die zu verleihen sind, kommen zwei weitere hinzu – bis 1985 gab es in Hof keinen einzigen Preis –; ansonsten scheinen die Organisatoren daran festzuhalten, das Festival nicht zur Show im Breitwandformat aufzublähen, sondern aufs bewährte Konzept zu bauen: Es besagt, dass es im ungroßstädtischen Home Of Films, bei erfreulich kurzen Wegen, in erster Linie um Filme und nicht Flitter, um Menschen und nicht um Outfits, um Regiekunst und nicht um einen roten Teppich, dafür auch um Fußball und Bratwürste geht. Lux, der halbe Superheld aus Daniel Wilds (2017 mit dem Heinz-Badewitz-Preis prämiiertem) Filmdebüt, steht fürs Hofer Filmfest und fürs Kino überhaupt, das wie die Berliner Nacht ungreifbar aus nichts als Schein und Schimmer besteht: Seine Macher sind keine „Krieger“, aber Aktivisten des Lichts. ■
Lichtzeichen
20. Oktober Krise ist, wenn keiner weiß, wies weitergeht. Zeigt die Ampel Rot, geht’s nicht weiter – aber ist das schon Krise? Und was, wenn sie mit all ihren Farben gleichzeitig aufwartet, mit Rot, Gelb, Grün – so wie (vermutlich) demnächst im Bundesberlin: Müssen wir dann zornrot anlaufen oder grün, weil uns übel ist, droht gelbe Gefahr? Oder signalisiert uns die farbige Dreifaltigkeit blühendes Leben, goldene Zukunft und die Hoffnung auf beides? Zurzeit einigen sich viele Anhänger wie Gegner der scheidenden Kanzlerin darauf, die Ampel nach sechzehn Merkel-Jahren für das Symbol eines möglichen dynamischen Neuanfangs immerhin in Betracht zu ziehen. Freilich kommt, wer sich in Sachen Farbsymbolik ein wenig auskennt, nicht umhin, sie für eine heikle, weil vieldeutige Metapher zu halten. Dabei ging es der Vorrichtung, der sich unser bildhafter, in diesem Wochen grassierender Ausdruck verdankt, just ums Gegenteil: um Unzweideutig- und Unmissverständlichkeit nämlich, den Augenblick betreffend, in dem ein Autofahrer Gas geben darf oder besser auf die Bremse tritt. Wer an einer Straßenkreuzung Rot sieht, weiß: Nun muss er stehenbleiben, nicht weil Krise ist, sondern um zu vermeiden, dass, weils kracht, eine entsteht. Darüber, wann das Ursprungsjahr solcher Lichtzeichenanlagen anzusetzen sei, herrscht keine Einigkeit: Manche Quellen nennen bereits den Dezember 1868, weil da im noch nicht motorisierten London vor dem Parlament erstmals entsprechende Signale den Kutschern Zeichen gaben, mittels Gaslichtern, die bereits die noch heute gebräuchlichen Farben zeigten. Rot und Grün strahlten auch die elektrischen Leuchten, die vom 5. August 1914 an in Cleveland, US-Bundesstaat Ohio, den immer stärker von Automobilen geprägten Verkehr regeln sollten. Die erste Berliner und damit deutsche Ampel leuchtete zehn Jahre später von einem Türmchen am Potsdamer Platz herab; in acht Meter Höhe thronte ein Schupo auf des fünfeckigen Turmes Spitze in einem verglasten Kabinchen mit Rundumsicht und besorgte den Farbwechsel von Hand. Berichtet wird, dass sich die Autofahrer zwar nolens volens auf die Verbots- und Freie-Fahrt-Zeichen einließen, die Fußgänger sie jedoch vielfach gleichgültig bis provozierend ignorierten. Die Ampel speziell für Passanten per pedes ist eine Erfindung der dänischen Hauptstadt: Von 1933 an sorgte in Kopenhagen ein Prototyp für ein geregeltes stop and go. Während 1952 die New Yorker Verkehrsbetriebe dazu übergingen, den Fußgängern schriftlich die Befehle „Walk“ und „Don’t walk“ („Geh“ und „Geh nicht“) zu erteilen und damit eine gewisse Lesefähigkeit voraussetzten, machten es, zum Beispiel, die Kollegen in Deutschland den Bürgern durch die Ampelmännchen leichter, wobei die ostdeutschen, mit Riesenschritt und breitem Hut, auch nach dem End der DDR ikonische Signalkraft entfalten. Die Ampel, in dieser Weise begriffen, hat für uns stets mit unserer Mobilität zu tun: Gemäß ihrem Diktat bewegen wir uns – oder, abwartend, eben nicht. Das widerspricht indes dem ursprünglichen Begriff und ihrem Gebrauch: Das Wort, vom lateinischen ampulla für kleines (Öl-)Fläschchen abstammend, bezeichnete zunächst eine –Hängelampe, im Mittelalter vor allem die „ewigen“ Lichter in Sakralbauten und vor heiligen Bildern. Von alters her also hat die Ampel mit Erleuchtung zu tun, und derer bedarf jede wie auch immer kolorierte Koalition im Lande, will sie krisenfest durch die kommenden vier Jahre kurven. ■
Kalte Füße
16. Oktober Wir leben, wenn wir uns mit den Menschen in den ärmeren und armen Ländern vergleichen, auf zu großem Fuß, und falls wir uns nicht bald auf der Hacke umdrehen, um die zahllosen Ungerechtigkeiten wenigstens mildernd auszugleichen, die der Globalisierung auf dem Fuße folgen, so kann uns und den nächsten Generationen unser Luxusdasein mächtig auf die Füße fallen. Manche Kenner der Weltlage sagen, Massen unterprivilegierter Zeitgenossen in der so genannten Dritten und Vierten Welt stünden längst Gewehr bei Fuß, um in unsere vermeintlichen Paradiese vorzudringen – man muss nicht miesepetrig mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden sein, um zu begreifen: Zeit für uns, allmählich kalte Füße zu bekommen. Nicht zuletzt dadurch treten wir den Menschen in den weiten, breiten Elendsregionen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas auf die Füße, dass der ökologische Fußabdruck unserer Wirtschaftsnationen ungleich größer ausfällt als jener, den ihre von den reichen Ländern klein gehaltenen Volkswirtschaften auf der Erde hinterlassen. Immerhin schreitet der eine oder andere Prominente auf unserer begünstigten Hälfte des Globus mit gutem Beispiel voran. Dieser Tage verkündete Prinz Charles, der 72-jährige ewige Anwärter auf Großbritanniens Thron, er werde mithilfe eines wochenweise strikt formulierten Ernährungsplans seinen Anteil an der Verwüstung zu minimieren suchen, die unser Ressourcenverbrauch auf dem Planeten anrichtet: Jeweils an zwei Tagen, so teilte er der BBC mit, verzichte er auf den Genuss von Fleisch und Fisch, an einem weiteren Tag auf Milchprodukte. Ein Entschluss, der Hand und Fuß hat, zumal wenn man bedenkt, dass Ersatzprodukte oft wie eingeschlafene Füße schmecken. Wird aber die Regeneration der Schöpfung durch ein paar verstreute Menschen ehrenwerten Willens allmählich Fuß fassen können? Müsste dafür nicht jeder von uns, so schwer es fällt, sein ganzes Verhalten vom Kopf auf die Füße stellen, und zwar lieber heut als morgen? Denn die Zeiten sind vorbei, in denen es reichte, bei der Rettung der Welt gemächlich einen Fuß vor den anderen zu setzen. So viel Geduld durften sich schon unsere urgeschichtlichen Vorfahren nicht erlauben: Sie mussten die Beine in die Hand nehmen, ob sie nun vorm hungrigen Säbelzahntiger Fersengeld gaben oder jagend der Fährte eines Mammuts folgten. Das liegt freilich zigtausend Jahre zurück. Noch weit älter indes sind die frühesten bekannten Fußabdrücke von Herrentierarten, die zwar auf gutem evolutionärem Weg waren, sich zu Menschen zu entwickeln, aber noch keine waren: Vor über sechs Millionen Jahren traten sie in den Sand, dort, wo heute die Insel Kreta im Mittelmeer schwimmt, wie vor wenigen Tagen die Universität Tübingen mitteilte. Einer ihrer Mitarbeiter, Uwe Kirscher, gehörte der Wissenschaftlergruppe an, die – bereits 2017 – die Stapfen in Strandsedimenten entdeckte. „Die Spuren sind nahezu zweieinhalb Millionen Jahre älter als die Laufspuren aus Tansania, die Australopithecus afarensis (Lucy) zugeschrieben werden“, berichtet Kirscher, und sein Kollege Per Ahlberg aus dem schwedischen Uppsala ergänzt: „Dieser älteste menschliche Lauffuß hatte eine kürzere Sohle als Australopithecus, und die Ferse war schmaler.“ Trotzdem bleibt uns sein Besitzer einen Schritt voraus: Sein ökologischer Fußabdruck war um etliche Nummern kleiner als die Schuhgröße von Prinz Charles. ■
Alles in allem
9. Oktober Wohl in keiner Epoche der Literaturgeschichte, der deutschen zumal, gingen die Autorinnen und Autoren mit solch programmatischem Eifer ans Werk wie die der Romantik. In einer Fülle theoretischer Schriften arbeiteten sie sich daran ab, sich abzugrenzen von der Aufklärung, von deren materialistischem und ökonomischem Menschenbild, vom Hohn auf religiöse Spiritualität und empfindsames Seelenleben, von den Objektivierungen der immer exakteren Naturwissenschaften. Das Denken der Romantiker trachtete buchstäblich danach, alles in allem, Kreativität und Existenz in einer Gesamtkunst zu umfassen. Darum misstrauten sie der geschlossenen Form des ‚Werks‘ und verlegten sich lieber darauf, sich „ahndungsvoll“, andeutungsweise, bruchstückhaft zu äußern; setzten sie doch mehr auf eine vagabundierende Fantasie als auf den eindeutig schlussfolgernden Verstand und die reglementierte Vernunft. Fragment blieben viele ihrer Veröffentlichungen denn auch und hießen bisweilen gar so. Das hinderte sie nicht, mit Worten umzugehen, die fest gefügt und wie in Stein gemeißelt klangen. Friedrich Schlegel etwa publizierte 1798 in seiner Zeitschrift Athenäum ein „Fragment“ mit der (seither berühmten) Nummer 116, in dem es volltönend heißt: „Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie.“ Damit meinte er unter anderem: Die romantische Idee bekundet sich nicht in fertigen Ergebnissen von Analyse und Erkenntnis, sondern suchend in der Kunst, den Künsten; die Dichtung belässt es nicht bei schönen Worten, sondern schließt universell und fortschreitend (progressiv) alle möglichen alten und neuen Inhalte ein, auch Rhetorik und Philosophie, die Produktionen des Genies nicht anders als die der „Volksseele“; sie durchdringt die Existenz des Einzelnen wie das Zusammenleben der Gesellschaft und das Zeitalter insgesamt. Aus alldem folgt, dass die Romantik im Kern und dem Wesen nach eine literarische Erscheinung war; doch bildende Kunst und Musik folgten ihr gleichen Sinns auf je eigene Weise, und alle Kunstgattungen öffneten sich, eine vor der anderen, weit, so wie Lyrik, Epik und Dramatik es voreinander taten. Alles war in allem, und alles war möglich. Von einer „Schlüsselepoche“ der Kulturgeschichte spricht das Deutsche Romantik-Museum in Frankfurt/Main und will sie künftig folgerichtig „als Ganzes“ zeigen, wie es auf seiner Website heißt. Unlängst, Mitte September, wurde das weltweit erste Haus seiner Art eröffnet, nachdem das – der Förderung von Wissenschaft, Kunst und Bildung verpflichtete – Freie Deutsche Hochstift zehn Jahre lang an der Sammlung und ihrer Präsentation gearbeitet hatte. Der Verein betreut auch das Goethe-Haus und -Museum, neben dem nun für zwölf Millionen Euro der Neubau entstand. 1600 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung, um die Bedeutung der „romantischen Schule“ für die zeitgenössische Kultur wie auch für die Gegenwart zu beleuchten. Denn allen gut 220-jährigen ästhetischen Programmen zum Trotz: „Romantik“, als einen Zug des Unwillkürlichen in uns Menschen, der uns veranlasst, dem Gefühl, Gespür und der Ahnung den Vorzug vor Intellekt und Kalkül zu geben, für Schönes zu schwärmen, das Zarte zu lieben, vor dem Unheimlichen zu erschrecken und wie Kinder ans märchenhaft Gute zu glauben –, die gab es schon lang vor der Epoche dieses Namens, im Grunde seit Menschengedenken, und auch nach ihr ohne Unterbrechung. Ihre Theoretiker und Poeten übrigens haben sich selbst nie Romantiker genannt. ■
Wohin damit?
2. Oktober Dem Schreiber dieser Zeitung, einem bekennenden Verehrer der Werke Thomas Manns, wurde vor Jahren ein besonderes Glücksgut zuteil. Ein Arzt, im Begriff, aus Hof fortzuziehen, bot ihm an, er könne sich, wenn er sich beeile, ein auf Pressspan aufgezogenes und konturgerecht ausgesägtes, lebensgroßes Ganzkörperporträt des verehrten Erzählers kostenlos abholen. Tatsächlich durfte er eine halbe Stunde später den Aufsteller behutsam wie ein altehrwürdiges Familienmitglied in seinem Auto verstauen. Vor Jahrzehnten hatte die Tochter des Mediziners in der Freiheitshalle bei der Fernsehaufzeichnung einer Quizsendung geholfen, bei der unter anderem nach Literatur-Nobelpreisträgern gefragt wurde; die traten als eine Art Pappkameraden leibhaftig in der Show auf. Dem Mädchen wurde danach auf seine Bitte hin gestattet, die Thomas-Mann-Figur, die sonst wie die anderen im Müll gelandet wäre, nach Hause mitzunehmen, wo sie später ihr Dasein auf dem Dachboden fristete – bis zu besagtem Telefonat. Die private Episode verweist auf ein Problem, das sich Filmstudios, Fernsehanstalten und nicht zuletzt Theatern von Spielzeit zu Spielzeit, von Produktion zu Produktion aufs Neue stellt: Wohin mit Kostümen, Accessoires und Requisiten, die bis auf Weiteres nicht mehr gebraucht werden? Schnöd entsorgen? Das wäre Verschwendung, verschlang doch die Neuanfertigung und Aufbewahrung, Instandsetzung und -haltung der Kleider, Kulissen und des übrigen Zubehörs reichlich Geld, Zeit und Mühe; oft steckt gediegenes Kunsthandwerk darin, sodass es sich nicht selten um halbe Kostbarkeiten handelt. Gleichwohl ist das Fassungsvermögen noch des größten Fundus irgendwann erschöpft. Dann gelangt das Überzählige und Entbehrliche notgedrungen eben doch im Abfall. Unter günstigeren Umständen übernehmen Kostüm- und Requisitenverleiher, was noch taugt und nach was aussieht. Das eine oder andere tragen Schauspielerinnen, Sänger oder Angehörige des Balletts liebevoll nach Hause. Und immer wieder verschleudern die überlasteten Erstbenutzer so viel vom Aus- und Überschuss wie möglich an Besucher ihrer Tage der offenen Tür. In Gelsenkirchen-Schalke indes dienen die Altteile einem guten sozialen Zweck: Durch ihren Verleih und Verkauf unterstützt ein „gemeinnütziger, offener Fundus“ namens „Materialverwaltung on tour“ die freie Kunstszene, Privatpersonen und professionelle Ausstatter mit Stoffen und Bühnenbildern, Podesten oder anderen Materialien – vom Kunstblumenstrauß bis zur Uralt-Rechenmaschine – etwa bei Festivals und Kunstaktionen, Schultheaterproduktionen und Studentenfilmen, aber auch bei Firmenfeiern oder Straßenfesten. Desto günstiger fallen die Preise aus, „je kultureller und gemeinnütziger“ der Endzweck ist. Spender der Artikel sind Institute der Hochkultur, Unternehmen, Messebauer, Werbefilmer, auch Privatleute. Zum Schalker Warenlager, das in einer Kirche untergebracht ist, gehört überdies eine Kunstschule mit „offenem Atelier“ und kostenlosen Workshops. Schon seit 2013 gibt es ein vergleichbares Projekt, die „Hanseatische Materialverwaltung“, in Hamburg. Beider Vorbild, „Material for the Arts“, ist seit vierzig Jahren in New York tätig. In Hof übrigens hält Thomas Mann eindrucksvoll vor dem Arbeitszimmer des Schreibers dieser Zeilen Wacht, geduldig in sich ruhend selbst im Zeichen der Corona-Pandemie, deretwegen er gegenwärtig einen rosa Mundschutz trägt. ■
Der Weihnachtsmann
23. September Wie sich vor hochwohlgeborenem Publikum angemessen präsentieren, wenn man als Lehrerssohn und Komponist nicht gerade in der allerersten Reihe steht? Engelbert Humperdinck, ein Guter, aber kein Großer seiner Zunft, ließ sich offenbar leicht einschüchtern. 1891 von Cosima Wagner zusammen mit etlichen feinen Herrschaften zum Diner in die Bayreuther Villa Wahnfried geladen, befolgte zwar „gefällig wie immer“ die Bitte der Hausherrin, einige Sätze an die Gästerunde zu richten, jedoch: „Er tippte an das Weinglas“, erinnerte sich Siegfried Wagner später, „blickte freundlich um sich, räusperte sich ein paar Mal – und setzte sich wieder nieder, ohne eine Silbe gesprochen zu haben.“ Derart nachhaltig bedrückt, zumindest beeindruckt hatte ihn neun Jahre zuvor die Aura Richard Wagners, des „Meisters“ der deutschen hochromantischen Musikdramatik. Vom altersklugen Schöpfer des „Parsifal“, der die Fähigkeiten des 28-Jährigen erkannt hatte, war Humperdinck 1882 aufgefordert worden, ihm vor der Uraufführung des „Bühnenweihfestspiels“ als Assistent zu dienen; in einer der „Verwandlungsmusiken“ tönen denn auch, wenngleich ununterscheidbar, ein paar Takte aus seiner Feder mit. Bis der junge Mann, derart ausgezeichnet, sich vom Einfluss des charismatischen Genies lösen konnte, dauerte es seine Zeit. Zum Glück orientierte er sich anders: Nicht extraordinären, im Umfang entgrenzten Heldensagenstoffen, sondern der eher bündigen Form des Singspiels und der Gattung des Märchens wandte er sich als Opernschöpfer zu, und wenn auch seine Bühnenwerke fast sämtlich in Vergessenheit gerieten – ebenso wie seine Orchesterstücke und Kammermusiken –, so brachte er es doch zu einem one hit wonder, an dem bis heute kaum ein Theater vorbeikommt: 1893, am Tag vor Heiligabend, kam Humperdincks „Hänsel und Gretel“ im Weimarer Hoftheater heraus, mit keinem Geringeren als Richard Strauss am Pult. Entstanden war sein einziger, indes haltbarer Welterfolg aus einem häuslichen Kindervergnügen: Adelheid Wette, die Schwester des Komponisten, hatte aus Volkslied- und selbst gereimten Versen ein Märchenspiel verfertigt und den Bruder gebeten, ein wenig sinnfällige Musik dazuzugeben. Die Aufgabe bot ihm, wie er bekannte, Gelegenheit, „sich selbst wiederzufinden.“ Zwar nutzte er, im Komponierhandwerk glänzend versiert, die avancierten Methoden Wagners, ersetzte aber dessen Festspielbombast durch eigene Herzenseinfalt. Warum es ausgerechnet dieses Werk zur unanfechtbaren „Weihnachtsoper“ brachte – obwohl es im Sommer statt im Winter, im Wald statt am heimelig-heimischen Kamin spielt und wenig familiensinnig von armen Eltern erzählt, die ihre Kinder von sich stoßen –, das wird ein ewiges Rätsel bleiben. Vor jetzt hundert Jahren starb der gebürtige Siegburger, am 27. September 1921 in Neustrelitz, mit 67 Jahren. Wer weiß, ob er sich nicht doch noch mit einem unvergänglichen Alterswerk in die Musikgeschichte eingeschrieben hätte, wären ihm ein paar Jahre mehr vergönnt gewesen. Immerhin hatte sein britischer Namensvetter, der Popsänger Engelbert Humperdinck (der in Wirklichkeit Arnold George Dorsey heißt), schon 76 Jahre auf dem Buckel, als er 2012 das Vereinigte Königreich beim Eurovision Song Contest vertrat, als zweitältester Teilnehmer überhaupt. In die erste Reihe schaffte auch er es trotzdem nicht: Mit nur zwölf Punkten landete er auf dem vorletzten Platz. ■
Richtig falsch
16. September Der 48-jährige Kunsthändler, der Mitte Juli in Düsseldorf vor Gericht stand, darf fast für bescheiden gelten. Gerade mal 19000 Euro verlangte er für Arbeiten von A. R. Penck und Günther Uecker, die sie gewiss auch wert gewesen wären, hätte es sich, statt um Fälschungen, um Originale gehandelt. Ganz andere Gewinnmargen hatten sich die fünf Herrschaften zum Ziel gesetzt, die in der vergangenen Woche der italienischen Polizei ins Netz gingen: Nicht nur, dass die Beamten bei ihnen 3,5 Millionen Euro in Bargeld und Wertsachen fanden; vor allem stellten sie nicht weniger als fünfhundert Gemälde des 1992 gestorbenen Briten Francis Bacon sicher, die zwar mit Echtheitszertifikaten versehen, aber trotzdem offenbar gefälscht sind. Bedenkt man, dass Sotheby’s in New York vor acht Jahren Bacons „Three Studies oft Lucian Freud“ für umgerechnet über 120 Millionen Euro versteigerte, lässt sich wenigstens andeutungsweise vermuten, was sich mit den Imitationen auf dem Markt hätte erlösen lassen, wären gutgläubige Kunden auf sie hereingefallen. Wenn auch selten in vergleichbar horrender Dimension, so ereignet sich dergleichen doch immer wieder, zumal in einer Zeit, deren ästhetische Maßstäbe die Grenzen zwischen Werk und Plagiat, Urfassung und Kopie auch ohne kriminellen Hintergrund zunehmend verwischen. Zwar kommt ein Maler um den Vorwurf, ein Gauner zu sein, nicht herum, sobald er zum Zweck unlauterer Bereicherung ein Bild oder einen Stil so vollkommen nachahmt, dass die Doublette sich vom Original kaum noch unterscheiden lässt; andererseits wird einem Meisterfälscher wie Wolfgang Beltracchi, der 2010 ins Gefängnis einrückte, Kenner- und Könnerschaft, womöglich Künstlertum nicht abzusprechen sein. „In der Politik ist es wie in der Mathematik“, hat der einstige US-Senator Edward Kennedy klug behauptet: „Alles, was nicht ganz richtig ist, ist falsch.“ In der Kunst indes verhält es sich doch anders: Beltracchis reproduzierte Malereien, Grafiken und Skulpturen waren zwar richtig falsch, aber eben auch beinah echt. Neben ihnen verschwinden fakes wie Hitlers „Tagebücher“ aus der Werkstatt des übereifrigen Konrad Kujau oder dickleibige Doktorarbeiten dünnbrettbohrender Schwindler wie dem einstigen Polit-Wunderknaben Karl-Theodor zu Guttenberg als vermurkste Versuche hudelnder Amateure. Schon vor Jahrhunderten, ja Jahrtausenden wurden Geschichtsfälschungen lanciert, die zu gewichtigen politischen Entscheidungen, wenn nicht historischen Umschwüngen führten. Und auch in den angeblich so exakten Naturwissenschaften grassiert die Vorspiegelung falscher Tatsachen, wenn sich prestigeträchtige Projekte der Spitzenforschung und einträgliche Posten nicht anders halten lassen. Beinah ans Herz rührt da das kuriose Schicksal des Würzburger Gelehrten Barthel Adam Beringer, der sich 1725 reichlich plump hereinlegen ließ: Böse Buben drehten ihm wunderlich gebildete „Lügensteine“ an, die er begeistert für spektakuläre Fossilien, sogar für versteinerte Kometen und wahrhafte Signaturen von Gottes eigener Hand hielt. Zum Lachen? Wer ahnt denn, wie oft Ähnliches heute geschieht, nur weitaus geschickter ins Werk gesetzt? Wer kann Tag für Tag ausschließen, dass er selber irgendeinem Lug und Humbug arglos vertraut, dass er geschickten Täuschern ihre Attrappen und Falsifikate blauäugig abkauft? Manchmal meint man, die ganze Welt sei, wenn schon kein fake, so doch ein Fehler. ■
Darüber reden
9. September Wie wenig wir mit dem Phänomen umzugehen wissen, zeigt die Vielzahl der Wörter, die wir dafür ausprobieren. Wir mögen ja schon das Wort Tod nicht sehr, und wenn jemand sich selbst den Tod gibt, so sagen wir lieber, er nehme sich das Leben. Beschönigend lassen wir uns den „Freitod“ eingehen, indem wir so tun, als stünde ein selbstbestimmter Entschluss hinter dem finalen Akt, der doch oft der letzte Ausbruchsversuch aus einem Gefängnis der Unentrinnbarkeit ist. Umso roher sprechen wir von „Selbstmord“ und unterstellen mit dem juristisch definierten Begriff Mord dem, der ihn an sich begeht, er handle weniger heimlich als „heimtückisch“ und aus „niedrigen Beweggründen“; dabei geht fast jeder solchen Tat eine Phase der wachsenden Hoffnungslosigkeit voraus, der quälenden Leere oder der Depression, die der der Seele ist. Experten bevorzugen das fachchinesische „Suizid“, womit sie allerdings nur den Selbstmord bemäntelnd ins Lateinische übersetzen. Noch begütigender verharmlost die streichelzärtliche Wendung vom „Hand an sich legen“ die einsame Ausweglosigkeit dessen, der nicht anders mehr kann. So grausam und gewaltig ist der Zwang jener Seelennot, dass wir im Deutschen außer der steinkalten „Selbsttötung“ tatsächlich über keinen Terminus verfügen, der schonend, sachlich und zutreffend genug wäre, um ihn guten Gewissens zu gebrauchen. In offiziellen Verlautbarungen bleibt es darum beim zwar vernebelnden, immerhin aber schonungsvoll distanzierten Suizid. Seit 2003 ruft die Weltgesundheitsorganisation den 10. September, folglich heuer den morgigen Freitag, zum „Welttag der Suizidprävention“ aus, mit gutem Grund, beschließen doch etwa 800 000 Erdenbürger jährlich ihr Leben aus eigenem Antrieb – durchschnittlich mehr als neunzig pro Stunde. Jahr für Jahr sinds etwa zehntausend Männer, Frauen, Kinder in unserem Land, in dem es zwar ein rühriges „Museum für Sepulkralkultur“ gibt, also eine Schausammlung, die Grabmäler, Begräbnisformen und Totenkulte in ihrer Vielfalt in den Blick rückt. Noch nie aber hat sich das löbliche Kasseler Haus mit dem Suizid auseinandergesetzt. Nun, mit der Eröffnung morgen, holt es das nach: „Let’s talk about it“ ist die (bis zum 27. Februar geöffnete) Sonderausstellung überschrieben: Lasst uns darüber reden. Denn die Schrecklichkeit der Selbsttötung erfüllt sich in dem Paradox, dass sie sich zwar so gut wie nie unangekündigt ereignet, aber niemand davon sprechen will. Der Selbstmörder – das ist für nicht wenige von uns ein Feigling oder Versager, einer, ders nicht geschafft hat oder das nicht aushielt, was unzählige andere tapfer irgendwie wegstecken. In Wahrheit steigert sich im „Freitod“ der Mut der Verzweiflung bis zum Äußersten. Freilich kann man es sich leichter oder schwerer damit machen: Keinen Schmerz muss vermutlich der erdulden, der vom Hochhaus springt – den Aufprall nimmt sein Hirn wohl gar nicht bewusst wahr. Ganz anders erging es dem Studenten Jan Palach, der, dem fernöstlichen Beispiel buddhistischer Mönche folgend, sich am 19. Januar 1969 in der tschechoslowakischen Hauptstadt in Brand steckte: Mit seinem öffentlichen Selbstopfer demonstrierte er flammend gegen die gewaltsame Niederschlagung des „Prager Frühlings“ durch den Warschauer Pakt im Jahr zuvor: eine unausdenkbar unmenschliche Art, freiwillig zu sterben, um ein Zeichen gegen eine unmenschliche Zwangsherrschaft zu setzen. Darüber redet bis heute die Welt. ■
Alle Ewigkeit
2. September Wie groß ist das Meer? König Salomo, der sagenhafte Tempelbauer aus dem Alten Testament, hatte von Israels Küsten aus gerade mal ein bisschen Mittelmeer gesehen und von der Unermesslichkeit der Ozeane keinerlei Begriff. Das aber hinderte ihn nicht, in dem Haus, das er (der Bibel zufolge) um 950 vor Christus in Jerusalem seinem Gott errichtete, ein Meer zu installieren – ein „Ehernes Meer“. Als Sinnbild der Urfluten, die seinem Glauben zufolge vor der Schöpfung die Erde bedeckten, auch als Gefäß für rituelle Waschungen der Priester hatte es der Bildhauer Hiram Abif von Tyrus aus Bronze gefertigt: ein verziertes Becken, „von einem Rand zum andern zehn Ellen weit, ganz rund und fünf Ellen hoch“, wie das erste Buch der Könige berichtet: „Eine Schnur von dreißig Ellen war das Maß ringsherum.“ Das bedeutet, dass der Umfang der dreifachen Länge des Durchmessers entsprochen habe. Aber kann das stimmen, bei einem „ganz runden“ Kessel? Müsste der Kreis seines Rands nicht 31,41 Ellen betragen haben? Mag sein; nur kannte das alte Volk Israel die Kreiszahl Pi (π), das ist 3,1415926535897932 ..., so wenig wie sein König die Ausdehnung der Weltmeere. Mit dem handlichen Näherungswert 3 lag es nicht sehr verkehrt. Dreitausend Jahre später hat sich die verfügbare Genauigkeit jener Zahl beträchtlich erhöht: Dieser Tage meldete die Fachhochschule im schweizerischen Graubünden, an ihrem Datenzentrum habe ein „Hochleistungsrechner den [am 29. Januar 2020 aufgestellten] Weltrekord von fünfzig Billionen Stellen hinterm Komma um zusätzlich 12,8 Billionen neue, bis anhin unbekannte Stellen übertroffen“. Zauberei der modernen Wissenschaft. Als magische Zahl tritt Pi allerdings schon seit der Antike auf, und an mancherlei Orten der Welt. Ungefähr sechshundert Jahre vor dem Bau des salomonischen Heiligtums schrieb ein kluger Kopf Altägyptens die heute als „Papyrus Rhind“ bekannten Aufzeichnungen nieder, worin eine Kreiszahl von etwa 3,15 erscheint. Archimedes behalf sich ums Jahr 220 vor Christus, indem er 22 durch 7 teilte. Der im Jahr 500 gestorbene Chinese Zu Chongzhi kam mit dem Quotienten aus 355 und 113 dem korrekten Ergebnis mit sechs Stellen hinterm Komma imponierend nah. Freilich kann es ein ‚korrektes‘ Ergebnis in diesem Fall letztlich nicht geben, nicht in dem Sinn, dass menschlicher Verstand es zu greifen in der Lage wäre. Denn Pi ist eine „irrationale Zahl“, mithin eine, die sich abschließendem Denken sozusagen vernunftwidrig entzieht: Ohne erkennbare Regel setzen die Ziffern hinterm Komma sich offenkundig wie eine Urflut in alle Ewigkeit fort. Wie weit jener mathematische Ozean reicht, lassen seit 1949 erst die Computer ahnen: Mit Rechnerunterstützung spürte der US-Amerikaner George W. Reitwiesner damals 2037 Dezimalstellen auf; die Zehntausender-Hürde fiel 1958, die Millionen-Marke 1973 … Dass die jetzt 62,8 Billionen Ziffern hinter der harmlos haltbaren, seit den alten Ägyptern und Hebräern unverrückbaren 3 die Wissenschaft unmittelbar weiterbringen, ist nicht ausgemacht; der Fachhochschule kam es auch weniger auf die Kreiszahl selbst an als auf die ausgetüfteltste Methode, sie zu errechnen. Dafür benötigte das elektronische Superhirn in der Schweiz 108 Tage und neun Stunden – ein Wimpernschlag, gemessen an der Zeit, die der deutsch-niederländische Mathematiker Ludolph van Ceulen vor etwa vierhundert Jahren investierte: Um Pi auf nur 35 Stellen hinterm Komma exakt zu bestimmen, wandte er über zwanzig Jahre seines Gelehrtenlebens auf. ■
Zentren der Weisheit
26. August In manchen mittelalterlichen Quellen heißen die drei Städte untertreibend schlicht „Die Gemeinden“; in anderen Dokumenten, umso geheimnisvoller, SchUM. Kein kabbalistisch-kompliziertes Rätsel, nur ein vergleichsweise leicht aufzulösendes Akronym steckt hinter den Buchstaben, eine bequeme Abkürzung. Gemeint sind die seit dem zwölften Jahrhundert gebräuchlichen hebräischen Namen für Speyer, Worms und Mainz: Schpira, Warmaisa, Magenza. Bis zu den Pogromen ab der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts setzte die Allianz jener „Gemeinden“, als Zentrum von Glaube und Gelehrsamkeit der mittel- und osteuropäischen (aschkenasischen) Juden, Maßstäbe für deren Leben und Lehre, Religionsübung und Baukunst. Zu ähnlichen Hochburgen wuchsen sich Regensburg, Fürth und Hamburg aus. Die Geschichte antisemitischer Ressentiments und Repressionen hat den Juden in ihrer über 3000-jährigen Geschichte wiederholt stark und oft fast tödlich zugesetzt; doch nicht einmal der von den Nationalsozialisten ins Werk gesetzte Holocaust vermochte sie und ihre Überzeugung auszuradieren, von Gott auserwählt zu sein, mit ihm im Bund zu stehen und von ihm zwar geprüft, doch auch errettet zu werden. Heuer leben Juden – nachweislich durch ein sie erwähnendes Edikt des römischen Kaisers Konstantin des Großen – seit 1700 Jahren auf dem Gebiet Deutschlands, ein Jubiläum, das vielerorts vielfältig gefeiert wurde und wird. Und obwohl eben hier ihre grauenvollste Heimsuchung den Ausgang nahm, hat deutscher Boden bis heute nicht aufgehört, Nährboden für den Geist des lange heimatlosen und doch unzerstörbaren Volkes zu sein. Vor wenigen Tage wurde in Potsdam ein – zur Universität gehörendes – „Europäisches Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit“ eröffnet, dessen Gründung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wie ein „Geschenk für unser Land“ entgegennahm, öffne es sich doch Menschen aller Glaubensrichtungen. In der Lehr- und Forschungsstätte integriert sind eine Synagoge, deren modern-puristische Raumidee sich betont den orientalistischen Dekorklischees der Gotteshäuser aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert verweigert, sowie je ein Ausbildungsseminar für liberale und für konservativ orientierte Rabbiner. Europaweit hat die Einrichtung im Park von Sanssouci nicht ihresgleichen. Aber freilich finden Kultur, Bildung und Weisheit der Juden ebenso andernorts Kulminationspunkte in der heutigen Republik, so in Heidelberg, Düsseldorf – und Bamberg: Auch in Oberfranken also machen sich Studierende mit der Sprache und den heiligen Schriften, mit Kultur und Geschichte des Judentums, seiner Ethik und seinen Berührungsflächen mit den anderen Weltreligionen vertraut. Eine weitere Kernaufgabe ist der jüdisch-christliche Dialog, der, wie durch ein Wunder, auch nach und trotz der Schoah hierzulande nicht verstummt ist. So endete in der vergangenen Woche eine Sommerschule, bei der Studierende aus Köln und Brno/Brünn in Terezín/Theresienstadt, dem einstigen tschechischen „Vorzeige-Ghetto“ der Nazis, den ermordeten jüdischen Komponisten Viktor Ullmann, Hans Krása und Pavel Haas nachspürten. Und in Berlin nahmen dieser Tage Markus Lemke, Liora Heidecker und Yahin Onah den zum dritten Mal verliehenen Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis entgegen. Eine Auszeichnung wie diese verweist darauf, dass, wo eine gemeinsame Sprache fehlt, Vermittler auftreten müssen, die in beiden Sprachen daheim sind. ■
Globales Theater
19. August Der Wettbewerb heißt Poetry by Heart, was im Deutschen dreierlei bedeuten kann: Poesie, die man auswendig aufsagen kann; Poesie, die aus dem Herzen kommt; und Poesie mit Herz. Bei Tabitha Sherlock kommt wohl alles zusammen: Im Juli reihte sich die Elfjährige aus Englands Nordosten durch ihren Vortrag zweier Gedichte in die zehn Besten jenes Rezitatorenwettstreits ein. Schauplatz des vor 400 Zuhörerinnen und Zuhörern ausgetragenen Finales: das Globe Theatre in London. Welche Auszeichnung für ein Kind. Denn der erlauchte Kunstort blickt auf vierhundert Jahre einer so illustren wie wechselvollen Geschichte zurück. 1599 wurde es von James Burbage, einem Kulturmanager mit großem Herzen für die Bühne, im damaligen Vergnügungsviertel Bankside im Süden der Hauptstadt errichtet: wahrscheinlich als runde oder achteckige Umbauung eines offenen Hofraums mit einem Durchmesser von etwa dreißig Metern. Während der Aufführungen standen die „Gründlinge“, die nur einen Penny Eintritt zahlen konnten oder wollten, unter freiem Himmel, während das Publikum, das zwei oder drei Pennys berappte, die wettergeschützte Galerie besteigen durfte oder auf Sitzen Platz nahm. Insgesamt passten zwei-, wenn nicht dreitausend Schaulustige hinein. Das Globe war Hauptspielort der Lord Chamberlain’s Men – der späteren King‘s Men –, jener Schauspielertruppe, der seit 1590 William Shakespeare angehörte und die vor allem die Stücke des englischen Großdichters aufführte. Den Namen hatte es von einem Schild an seiner Außenwand: Es zeigte den mythologischen Riesen Atlas, der sich mit einem Globus, der Weltkugel, auf seinem Rücken abschleppte. 1613 brannte das vielbesuchte Volkstheater ab und wurde im Jahr darauf prunkvoller wiedererrichtet, um dreißig Jahre später erst eigentlich unterzugehen: Die Puritaner, angetreten, mit der kultivierten Sinnenfreude des Elisabethanischen Zeitalters Schluss zu machen, hatten zwei Jahre zuvor alle Schauspielerei verboten und ließen es abreißen. Das Gebäude, mitsamt fast allen Erinnerungen an sein genaues Aussehen, ja an seine exakte Lage, verschwand spurlos – scheinbar: Denn 1989 traten bei Bauarbeiten Fundamentreste zutage. Bis 1996 erstand das Globe neu, dem Original so getreu wie möglich nachgebildet. Mit Shakespeares „Edlen Veronesern“ begann am 21. August vor 25 Jahren der Spielbetrieb, vorerst inoffiziell, ein weiteres Mal; das reguläre Premiere-Festival of Firsts startete schließlich am 7. Juni des Folgejahrs. Natürlich pflegen sie hier weiterhin das Œuvre des Dichters; und natürlich bekommt das Publikum „Dichtung mit Herz“ in moderner Gestalt geboten, in diesem Sommer etwa den magischen „Sommernachtstraum“ oder das lustige „Was ihr wollt“. Die amerikanisch inspirierte Szenerie für die Inszenierung jener Komödie bietet einen ramponierten Pickup-Truck, einen Karussell-Tiger und eine Jukebox auf, auch verschafft sich eine Jazzband Gehör. An Ganz- oder Teilnachbauten des alten Globe versuchten sich auch andere Städte. In Coburg, auf dem Gelände des einstigen Güterbahnhofs, soll mit Beginn der Spielzeit 2022/23 eine schmucke runde Fichtenholz-Architektur mit vier Geschossen die Aktiven und das Publikum des Landestheaters aufnehmen, dessen Generalsanierung ansteht. „Die ganze Welt ist eine Bühne“, wusste William Shakespeare. Er wusste noch nicht, dass seine Bühne, und überhaupt sein Theater, in vielerlei Hinsicht der ganzen Welt ein Beispiel geben würde. ■
Unter Bluthunden
12. August Aus der spanischen Geschichte im sechzehnten Jahrhundert ragt ein Antagonistenpaar heraus, dessen Wirken bis heute nachstrahlt: einer der furchtbarsten Pioniere des verhängnisvollen europäischen Kolonialismus; und einer der Väter der neuzeitlichen Menschenrechtsidee. Der eine, Hernán Cortés, hat vor jetzt fünfhundert Jahren, am 13. August 1521, das mittelamerikanische Tenochtitlan erobert, an der Stelle, an der sich jetzt, über Mauer- und Ruinenresten der damals blühenden Großstadt, die Kapitale Mexikos erhebt. Bei dem Coup seiner blutrünstigen Truppe halfen dem 36-jährigen Offizier entscheidend drei Umstände: Zum einen hießen die Azteken ihn zunächst ehrfürchtig willkommen, glaubten sie doch in ihm den weißen Gott Quetzalcoatl zu erkennen, dessen Erscheinen ihnen verheißen worden war; zum andern bestaunten sie eingeschüchtert die Pferde und Geschütze, Eisenrüstungen und -waffen der Fremden – dergleichen hatten die geschätzt an die 200 000 Einwohner noch nie gesehen; und schließlich gab ihr Immunsystem wehrlos den Krankheitskeimen nach, mit denen die Eroberer sie infizierten. Dem finalen Schlag gegen die prächtige und unermesslich reiche, wie ein transatlantisches Venedig auf Inseln in einem See errichtete Metropole und ihrer fast vollständigen Zerstörung war eine elfwöchige Belagerung vorausgegangen. Ihr folgten die brutale Versklavung der Bevölkerung, restlose Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und ihrer Ressourcen sowie Grausamkeitsexzesse von sadistischer Unmenschlichkeit. Dies alles geschah nicht immer unmittelbar im Namen, aber doch mit Billigung der spanischen, an den Goldschätzen „El Dorados“ brennend interessierten Krone Spaniens, die mit der systematischen Plünderung und Zwangsmissionierung ihrer neuen Kolonien in Lateinamerika den Weg zu einer „ersten Globalisierung“ eröffneten, wie die Historiker heute sagen. In jener schreckensreichen Epoche imponiert, als humanistischer, humanitärer Widerpart des iberischen Bluthunds Cortés, der Geistliche Bartolomé de Las Casas: Elf Jahre älter, hatte der Dominikaner jahrelang die Gräueltaten seiner Landsleute entsetzt beobachtet und bereits 1515 vor dem spanischen König und deutschen Kaiser Karl I./V. bittere Klage gegen die Meuchelmörder geführt. 1552 stattete er einen „Kurzgefassten Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder“ ab: Darin erzählt er unter anderem von Wetten unter der spanischen Soldateska, wer wohl einen lebendigen „Indianer“ mit einem einzigen Schwerthieb in zwei Hälften teilen könne; auch schildert die Denkschrift, wie die gnadenlosen Krieger ihren Gefangenen Köpfe, Hände und Füße abhackten, die Zungen herausrissen, sie auf Gittern über kleiner Flamme qualvoll zu Tode rösteten … Der deutsche Schriftsteller Reinhold Schneider nahm 1938 die Begegnung zwischen dem mutigen Kleriker und dem Kaiser, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, zum Ausgangspunkt für seine Erzählung „Las Casas vor Karl V.“: Am Beispiel der ausgerotteten Azteken prangert sie die Entrechtung und drohende Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten an. Symbolisch, aber offensichtlich setzt das lesenswerte Buch ein Zeichen gegen jede Politik der Repression, des Rassismus und der totalitären Ideologie. „Wir können“, heißt es darin, „mit schlechten Mitteln nichts Gutes erreichen“ – ein simpler, starker Satz fürs Stammbuch aller Machthaber gestern, heute, morgen. ■
Ein Staatskünstler
Dienstag, 7. August Der Leser sage hinterher nicht, man habe ihn nicht gewarnt: kündigt doch der Autor ihm unmissverständlich „die unsittlichste Erzählung seit Anbeginn der Welt“ an, denn alle sexuellen Handlungen und Misshandlungen, die sein skandalumwittertes Buch ausbreite, gingen als „Verbrechen oder Schändlichkeiten“ vonstatten. Als sich Donatien Alphonse François de Sade 1785 mit einer selbst in der Geschichte der pornografischen Literatur kaum je erreichten Hemmungslosigkeit und Schreibwut seinen kruden Imaginationen hingab, saß er für Jahre als Häftling in der Pariser Bastille ein. Im Kerker von aller weiblichen Gesellschaft dauerhaft abgeschnitten, spann er nicht weniger als sechshundert Perversionen aus, die er auf vier unersättliche hohe Herren – einen Herzog, einen Kleriker, einen Richter und einen Finanzmagnaten – sowie auf vier Monate und 42 unmündig-unschuldige Missbrauchsopfer weiblichen und männlichen Geschlechts aufteilte. Deren Schändung, Folterung und Massakrierung beschreibt er in den „Hundertzwanzig Tagen von Sodom“ minuziös: Zunächst gehen die Vergewaltiger noch vergleichsweise konventionell zu Sache, steigern sich dann aber zu unerlaubten bis widerrechtlichen Methoden, um schließlich ihre lasterhafte Lust mit dem Tod der gepeinigten Leidtragenden zu krönen. Unter den Werken des Schriftstellers, von dessen Namen die sexualpathologische Forschung den Begriff des Sadismus – für das wollüstige Vergnügen an der Demütigung und Qual anderer – ableitete, gilt dieses als das wichtigste; als so wichtig sogar, dass es der französische Staat für geboten hielt, die Handschrift zu erwerben. Die Gelegenheit ergab sich, weil ihr letzter Besitzer, der Unternehmer Gerard Lheritier, wegen Betrugsverdachts ins Visier der Behörden geriet: Als seine Firma 2017 liquidiert wurde, sicherte sich die Regierung den Zugriff auf die Urschrift, indem es sie, um die Ausfuhr zu einem privaten, womöglich ausländischen Käufer zu unterbinden, zum „Nationalschatz“ erklärte und nach Sponsoren für den Erwerb suchte. Der kam teuer: 4,55 Millionen Euro brachte Emmanuel Boussard als Mäzen unlängst dafür auf; der ehemalige Bankier ist der Enkel eines früheren Leiters der Pariser Bibliotheque de l’Arsenal, wo das Manuskript nun seine Bleibe findet. Ein „Kulturdenkmal“ nennt es das verantwortliche Ministerium, einen „Klassiker“ der „aufrührerischen Kritik und Fantasie“. Tatsächlich unterließ es de Sades Einbildungskraft in keiner Episode, aufs Brutalste dem aufklärerischen, für Frankreich von Jean-Jacques Rousseau normativ formulierten Grundsatz der Aufklärung zu widersprechen, der Mensch sei von Natur aus gut, ganz ohne Gott und kirchliche Morallehre, aus eigener Anlage und Kraft. Für seinen Gegenentwurf war ihm kein Einfall zu scheußlich, um ihn durch die vier Schänder des Plots (von Handlung lässt sich kaum sprechen) ins Werk setzen zu lassen. Denn die streben ja nicht eigentlich nach immer höheren Gipfeln ihrer Lust, sondern nach der Erforschung und Vollendung des ultimativ Bösen in der menschlichen Natur. So singulär die ausgemalten Ungeheuerlichkeiten, so einzigartig das Manuskript selbst: De Sade wickelte das beidseitig beschriebene Papier zur Rolle auf, zwölf Meter lang, elf Zentimeter breit. Unzählig die Zeilen, winzig das Gekritzel: Wer in der „Schule der Ausschweifung“ (so der Untertitel) aus der Urschrift lernen will, muss genau hinschauen und gründlich studieren. ■
Wuth und Weiblichkeit
Dienstag, 3. August Marek Janowski ist Dirigent. Und er ist ein Mann. In der Welt der klassischen Musik – von der die Dirigentin Oksana Lyniv aus gutem Grund sagt, sie sei „konservativ“ – scheint sich das Eine ohne das Andere kaum denken zu lassen. Noch. „Wenn die Qualität stimmt“, sagt Janowski, seit 2013 amtierender Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, sei das Geschlecht der Person, die ein Orchester leitet, „unwichtig“ – Frau oder Mann: heute kein Thema mehr. Ob er da nicht falsch liegt? In der Republik musizieren etwa 130 professionelle Orchester – nur bei fünf standen 2019 Frauen als Chefinnen am Pult. Gegenwärtig allerdings, das hängt auch mit den aktuellen Bayreuther Festspielen zusammen, machen sie von sich reden. So hat es die erwähnte Oksana Lyniv auf dem Grünen Hügel der Wagner-Kapitale in den Graben geschafft: Bei der Neuproduktion des „Fliegenden Holländers“ (über die ho-f demnächst berichten wird) wirkt sie dort als erste Frau in der 145 -jährigen Festivalgeschichte. In Nürnberg bejubeln konservative wie fortgeschrittene Klassikfreundinnen und -freunde die längst auch international gefeierte Joana Mallwitz. Noch. Nach achtzehn Jahren Festanstellung an unterschiedlichen Opernhäusern wolle sie dem Staatstheater 2023, nach knapp fünf Jahren, den Rücken kehren, teilte die 34-jährige Künstlerin mit, die sich darauf freut, im Herbst ihr erstes Kind zu bekommen, und sich darüber ärgert, dass Nürnberg sein geplantes Konzerthaus nun nicht kriegen soll. Jetzt wolle sie den Fokus wechseln. Eben jenen, den Brenn- und Mittelpunkt, legen die Philharmoniker in Sachsens Metropole demnächst auf die Arbeit mit Frauen als Orchesterleiterinnen: Frauke Roth, Intendantin des Ensembles, hat für die Saison 2021/22 fünf Damen ans Pult geladen, darunter Joanna Mallwitz, die, wenn sie schon mal da ist, im Mai nächsten Jahres auch gleich in der (ab 2024 von einer Frau, der Schweizerin Nora Schmid, geführten) Semperoper debütieren wird. Warum aber gibt es, neben so vielen Männern, die den Taktstock schwingen, so wenige Frauen, die dasselbe tun – oder die mans tun lässt? Und dürfen sich fortgeschrittene Klassikfreunde mit dem Hinweis begütigen lassen, es sehe damit heutzutage immerhin ein wenig besser aus als früher? Arg kurz ist die Historie der dirigierenden Frauen tatsächlich und seit jeher dünn besät: Sie begann etwa mit Fanny Hensel, der 1847 gestorbenen Schwester Felix Mendelssohn Bartholdys, und setzte sich unter anderen mit der Britin Ethel Smyth (1858 bis 1944) oder der vor allem als Klavierpädagogin legendären Nadia Boulanger fort, die 1979 starb – die Damen komponierten nicht nur, sondern ließen es, fast als Erste, sich auch nicht nehmen, ihre Schöpfungen selbst zu dirigieren. Über das empörende Ungleichgewicht von Männern und Frauen (beileibe nicht nur) im Musikbetrieb informiert sachlich und fundiert das Digitale deutsche Frauenarchiv im Internet. Dort findet sich auch eine Online-Version des 2002 von Elke Mascha Blankenburg als Buch veröffentlichten „Europäischen Dirigentinnen-Readers“: Über neunzig Damen mit teils imponierenden Biografien macht er namhaft und nährt auch in männlichen Lesern das Unverständnis der ungehaltenen Fanny Hensel, aus deren Briefen die Website Musik und Gender im Internet wie folgt zitiert: „Dass man seine elende Weibsnatur jeden Tag von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekommt, ist ein Punkt, der einen in Wuth und somit um die Weiblichkeit bringen könnte.“ ■
Ein Markenname
Samstag, 31. Juli Gelegentlich haben kleine Städte den Metropolen den Vorzug voraus, mit ihrem Namen für ein einzigartiges, die Zeiten überstrahlendes oder übertönendes Projekt zu stehen. Bei Bayreuth, zum Beispiel, sinds die Richard-Wagner-Festspiele, die selbst in Corona-Zeiten unvermindert vernehmlich den Namen der oberfränkischen Kapitale als Markennamen der Mutter aller Festivals in die Welt hinausrufen. Ähnlich steht es mit Weimar – ein Wort, das die Herren Goethe und Schiller, Herder und Wieland zum Synonym für die deutsche klassische Literatur ummünzten. Oder das Bauhaus, das vor allem unterm Schlagwort Dessau formiert. Oder die Internationalen Filmtage, die Hof in ein Home of Films verwandeln ... Einen kleineren, indes nicht geringeren Resonanzraum bietet seit jetzt hundert Jahren Donaueschingen im Konzert der Kultur, und dies nicht, weil sich in der 22 000-Einwohner-Kommune regelmäßig Drachenbauer, Turnierreiter und Windhund-Züchter zu Wettbewerb und Austausch treffen; denn das tun sie. Viel eindringlicher wirkt die Stadt auf neugierige Musikfreunde rund um den Globus mit den „Donaueschinger Musiktagen“, jährlich am dritten Wochenende im Oktober (also etwa zugleich mit den Hofer Filmtagen). Damit ist bereits einer von mehreren Kernbegriffen gefallen, um die herum sich das Festival formiert; verdankt es sich doch der „Gesellschaft der Musikfreunde“, die sich 1913 gründete. Allerdings dauerte es eine gute Weile, bevor sie 1921 erstmals „Kammermusik-Aufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst“ ausrichtete – die einen weiteren Kernbegriff anführten: Beim Eröffnungskonzert am 31. Juli erklangen, unter anderen, klein besetzte Werke der Neuen Wiener Schule – also der Trias Berg–Webern–Schönberg – und von Paul Hindemith; der begann im selben Jahr, die Maßstäbe setzende Serie seiner sieben „Kammermusiken“ zu komponieren. Drei Jahre später setzte er sich an die Spitze des fürs Programm zuständigen „Arbeitsausschusses“. Der Geburtsstunde der vom Start weg vielbeachteten Musiktage verdankte Hindemith den gleichsam offiziellen Aufstieg zu den führenden Neutönern seiner Zeit. Träger illustrer Namen hatten zuvor auch Pate für das Musikfest gestanden: Dem „Ehrenausschuss“ gehörten neben anderen zeitgenössischen Tonsetzern Franz Schreker und Richard Strauss, Hans Pfitzner und Ferruccio Busoni an. Fortan weitete „Donaueschingen“ sein Interessensgebiet aus und setzte von Jahr zu Jahr neue Schwerpunkte. Zu den Wechselfällen seiner Geschichte zählt ein zeitweiliger Umzug nach Baden-Baden, die nazibraune Einfärbung während der Hitler-Diktatur, stark stolpernde Versuche der Wiederbelebung nach 1945 und die für Stabilität sorgende Verbindung mit dem Südwestfunk (heute: Südwestrundfunk). Auch am Namen wurde wiederholt – und teils umständlich – gebastelt. Kurz und knapp „Donaueschinger Musiktage“ heißt das Festival seit 1971. Ausgeweitet hat sich hingegen der Kulturbegriff: Neben Konzert-, performativer und computergesteuerter Musik für alle erdenklichen Instrumente und Besetzungen, für Stimmen und Elektronik spielen längst auch die übrigen Künste hinein. Und immerhin zur Hälfte fand hier Loriots seit Jahrzehnten drängende Frage eine Antwort, ob es „auch Opern mit Hunden“ gebe: 2008 gab es, als Klanginstallation, „Musik für Hunde“. ■
Ziemlich neu
Dienstag, 27. Juli Das Theater Europas wurde zwei Mal erfunden: zuerst im antiken Griechenland bei rituellen Festspielen im Geist des gut gelaunten Gottes Dionysos; und abermals in den christlichen Gotteshäusern des Mittelalters durch inszenierte Episoden der biblischen Geschichte. Ähnlich verhält es sich mit den Bayreuther Festspielen, die Richard Wagner stiftete, um das Theater nach Möglichkeit zum dritten Mal ins Leben zu rufen, aus dem Geist seiner Musik, der Tragödie und der Erlösung. 1876 eröffnete er, mit dem „Ring des Nibelungen“, sein Festspielhaus. Vor siebzig Jahren, am 29. Juli 1951, wurde das Festival zum zweiten Mal begründet, jetzt in ziemlich neuer Gestalt. Denn wie bei einer Überschwemmung war zuvor viel braune Brühe uneindämmbar durch die „Wagnerscheune“ geflossen. Von 1931 bis 1944 hatte Winifred, die Schwiegertochter des dichtenden Komponisten, als glühende Nationalsozialistin das Unternehmen geleitet – und in die Arme Adolf Hitlers geführt. Den empfing der Bayreuther Clan familiär als „Onkel Wolf“; die Patriarchin pflegte ihn gar bis zu ihrem Tod als „USA“ – Unseren seligen Adolf – zu titulieren. In Wagner meinte der Tyrann den „größten Deutschen, der je gelebt hat“, zu erkennen, in seiner dionysischen Mythenwelt den reinsten Ausdruck germanisch-arischen Übermenschentums. Doch nach zwölf Jahren massenmörderischer Diktatur und sechs Jahren Krieg war die Welt übersatt geworden an deutscher Weihe und deutschem Wesen. Im Götterdämmerlicht des Weltenbrands versunken, schien der Bayreuther Familienbetrieb für alle Zukunft desavouiert; den amerikanischen Besatzungssoldaten war das hehre Haus auf dem Grünen Hügel für schmissige Tanzvergnügen genehm. Nach Auschwitz schien es, dass (dem Diktum Theodor W. Adornos zufolge) nicht nur „kein Gedicht mehr geschrieben“, sondern auch kein deutsches Festspiel mehr den Völkern zugemutet werden könne. Doch das dominante Wagner-Gen, das den „Meister“ Unmögliches hatte versuchen und vollbringen lassen, wirkte in den Enkeln Wieland und Wolfgang fort. Der „Überlieferung“ nahmen sie sich an, wussten aber, dass die allein durch „Neugestaltung“ zu bewahren war. „Es gibt nichts Ewiges“, postulierte Wieland, künstlerisch die treibende Kraft des Brüderpaars, und arbeitete Großvaters Sagenwelt um, den ausgenüchterten Zeiten gemäß. So nahmen denn die alten Festspiele weitgehend runderneuert ihren zweiten Anfang: Die „entrümpelte“ Bühne zeigte auf halbdunkler Scheibe die Dramen entmythologisiert, der Schauplatz des Regisseurs – der zugleich die Szenerien entwarf – war abstrakte Leere, von Kulissen und Requisiten fast vollständig freigeräumt, ein gegenstandsloser Ort, auf dem Punktscheinwerfer das stilisiert sparsame, psychogrammatisch minuziös festlegte Spiel der Figuren hervorhob. Dabei ließ Wieland Wagner die originalen Regieanweisungen links liegen und hielt sich ausschließlich auf den von ihm gedeuteten Erzählstrom von Dichtung und Musik. So wurde der Künstler, der, noch bevor er fünfzig war, 1966 starb, zu einem Pionier des modernen Regietheaters. Wie seine Gesinnungsfreunde unter den nachgeborenen Kollegen zog er zwar Respekt, ja Bewunderung auf sich und seine Arbeit, aber freilich auch Befremden und Ablehnung. Dass alles wegweisend Neue unbequeme Zumutungen an die Trägheit der Masse stellt – dies immerhin war immer so und scheint wohl „ewig“ so zu bleiben. ■
Furchtbare Funde
Samstag, 24. Juli Archäologie geht so: Ein Mann, angefixt durch den Blick auf eine uralte Landkarte, setzt sich einen fedora hat aufs Haupt, bewaffnet sich mit einer zwei Meter langen Bullenpeitsche und bricht überstürzt auf in ein Land, in dem es abenteuerlich und unzivilisiert zugeht. Dort spürt er bislang unbekannte, bevorzugt unterirdische Verstecke sagenhafter Reichtümer, magischer Kultobjekte (etwa von Kristallschädeln) oder Überbleibsel mythischer Epochen (wie der Bundeslade) auf, bricht mit Spitzhacke, Spaten und Sprengstoffen zu den todbringend gesicherten Schatzkammern durch, atomisiert dabei tonnenweise archaische Artefakte und raubt in bewährter westlicher Kolonialisten-Manier das ins Auge gefasste Fundstück von unschätzbarem Wert, das er in seine Heimat entführt, während er nebenbei kaltschnäuzige Konkurrenten, zum Beispiel Nazis, das Fürchten lehrt. – Nein, so geht Archäologie natürlich nicht, mithin nicht so, wie sie in den unterhaltsamen, aber absurden „Indiana Jones“-Filmen der Titelheld betreibt. Seit Jahrzehnten beharren Fachwissenschaftler im Gegenteil darauf, verantwortungsvoll grabende Altertumsforschung giere nicht nach Ruhm und Reichtum menschlicher Maulwürfe und ihrer imperialistischen Auftraggeber, sondern ermittle greifbare Fakten im Dienst solider historischer Hypothesen; sie beute Kulturen und ihre Geschichte nicht aus, sondern schone Fundorte und -stücke, die sie ihnen verdanke. Archäologie – eine anspruchsvolle Arbeit, die nach zunftgerechter Kompetenz, großer Behutsamkeit und reichlich Geduld verlangt und selten mit dem Bagger, meist mit Pinsel und Spatel verrichtet wird. Belohnt sehen sich die Forscher durch viel Aufregendes, das sie aufdecken: allein im vergangenen Jahr etwa durch die Freilegung kunstreich bemalter Sarkophage in der altägyptischen Totenstadt Sakkara, oder durch das mit über fünftausend Jahren weltweit älteste Ortsschild bei Assuan, oder durch einen geradezu neuzeitlich anmutenden Schnellimbiss in Pompeji (ho-f berichtete), oder durch 425 Goldmünzen aus dem Israel vor elfhundert Jahren … – oder, in diesem Monat erst, durch eine prachtvoll verzierte Goldfibel aus dem siebten Jahrhundert in einem Acker bei Wesel. Viele Fundsachen sind wunderschön und lassen staunen. Ebenso indes brauchen wissenschaftliche Ausgräber starke Nerven, erzählt ihre Ernte doch auch von unheimlichen Ritualen und Schlimmerem: von Gemetzeln und Quälereien. So tauchten, einer einschlägigen Publikation vom Mai zufolge, in einer polnischen Höhle die Knochen eines halbverhungerten Kindes auf, das offenbar um 1655 während einer heidnischen Zeremonie mit einem Buchfinken zwischen den Zähnen bestattet worden war. Fast zur selben Zeit berichtete eine Zeitschrift, auf altrömischen Friedhöfen in England seien die Reste von siebzehn Menschen aufgetaucht, die ihre Köpfe ganz offensichtlich durch das Richtschwert verloren hätten. Die Kopfknochen eines ums Jahr 800 besonders schmählich hingerichteten Mädchens offenbarte bei Untersuchungen im vergangenen Jahr deutliche Hinweise darauf, dass man ihm, als Strafe, Nase und Lippen abgeschnitten und wahrscheinlich auch die Kopfhaut abgezogen hat … Dergleichen lässt wohl selbst hartgesottene Experten schaudern. Wer verzückt die Goldmaske des Pharaos Tutanchamun oder die Himmelsscheibe von Nebra bewundert, sollte nicht vergessen, dass der Erdboden nicht zuletzt unzählige Zeugnisse bestialischer Unbarmherzigkeit bereithält. ■
Besondere Säfte
Dienstag, 20. Juli Das wahrhaft Heilige schreckt auch vor dem Peinlichen und Genierlichen nicht zurück. So zogen die Menschen in Calcata bei Prozessionen mit der Vorhaut Jesu Christi einher, die der spätere Messias fast zweitausend Jahre zuvor durch das blutige Ritual der Beschneidung eingebüßt hatte; erst 1983 kam den Bewohnern des mittelitalienischen Marktfleckens das Reliquiar mit dem sanctum praeputium abhanden. Desgleichen fanden sich im Sortiment des mittelalterlichen Reliquienhandels Phiolen mit der Muttermilch Mariens, vielleicht von Jesu Mutter selbst abgepumpt und konserviert. Bis zur Säkularisation des neunzehnten Jahrhunderts bewahrte ein Kloster in der Nähe Solingens gar Exkremente jenes Esels auf, der den bejubelten Jesus am Palmsonntag durch Jerusalem trug. Weniger Widerwillen mögen nüchterne Betrachter angesichts eines textilen Gewirks empfinden, das die Physiognomie des Heilands aufweisen soll: Das „Schweißtuch der Veronika“, besagt die Legende, habe die später heiliggesprochene Namensgeberin dem Blut und Wasser schwitzenden Jesus überlassen, damit er sich während seines letzten Gangs zur Marterstätte Golgotha das Gesicht abwische. Vielsagend bringt diese Historie die beiden Bedeutungen des Wortes Schweiß zusammen: Es bezeichnet ja nicht allein das aus menschlichen und tierischen Hautdrüsen abgesonderte Salzwasser, sondern in manchen Dialekten und Jargons, etwa dem der Jäger, ebenso das Blut. Insofern beiden Flüssigkeiten fromme Verehrung zuteil wird, handelt es sich bei der einen wie der anderen um einen „ganz besonderen Saft“. Für derart besonders erklärten die Programmmacher im Münchner Haus der Kunst den Schweiß, dass sie dort bis zum 9. Januar eine Schau mit dem lapidar-schockierenden Titel „Sweat“ zeigen. Darin präsentieren dreißig internationale Künstlerinnen und Künstler Arbeiten, die sich mit zwei verwandten schweißtreibenden Fähigkeiten des Menschen auseinandersetzen, der physischen Zähigkeit und geistigen Resilienz. Eine „lebensbejahende Schau“, versichert Kurator Raphael Fonseca; keinen geringen Stellenwert nehmen darum Exponate zum lateinamerikanischen Lieblingsthema Karneval ein. Vieles hat mit Tanz zu tun, zum Beispiel die durchgeschwitzten T-Shirts von Santiago Reyes, der sich in Innenstädten zwischen Berlin und Hanoi sausend, kreiselnd und springend bis zur Erschöpfung verausgabt hat. Weniger fröhlich, dafür unauflösbar vereinen sich Blut und Schweiß mit den Tränen zu einer sprichwörtlichen Trias: Jene Dreieinigkeit der Körpersäfte stellte Winston Churchill als britischer Premier seinen Landsleuten in Aussicht, als er ihnen 1940 in einer berühmten Ansprache zum Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland ein Höchstmaß an Opferbereitschaft abverlangte. Vermeintliche Tränen Christi fanden sich übrigens ebenfalls lange im Angebot klerikaler Reliquienproduzenten, und erst recht wurde und wird an vielen Orten „Heilig-Blut“-Heiltümern gehuldigt, im baden-württembergischen Kloster Weingarten so schwärmerisch wie in Brügge. Wem, im Mittelalter, das nicht reichte, der konnte unter günstigen Umständen eine Kapsel mit Jesu Atem erwerben oder (als Überbleibsel der zehn Plagen, mit denen der Gott der Hebräer das Land Ägypten heimsuchte) einen Behälter voll Finsternis; war die doch, wie das zweite der biblischen Mose-Bücher berichtet, so dick, „dass man sie greifen“ konnte. ■
Verlorene Zeit?
Samstag, 17. Juli Er litt an vielem, an manchen Krankheiten wirklich. Andere Malaisen redete er sich ein. Kein Zweifel, dass Marcel Proust, körperlich überhaupt von schwächlicher Konstitution, Asthmatiker war, einer von der schwer betroffenen Sorte, und das seit dem elften Lebensjahr. Auch seine Verdauung war nicht in Ordnung. Zugleich darf man ihn einen Hypochonder nennen: Eine „Neurasthenie“ schrieben die Ärzte ihm zu, also jenen Überreizungszustand von „Nervenschwäche“, den Mediziner vor gut hundert Jahren gern diagnostizierten, wenn sie an und in ihren Patienten sonst nichts Eindeutiges ermitteln konnten. Den Ärzten misstraute Proust bis zu seinem Tod 1922, wie die meisten Hypochonder. Verordnete Medikamente wies er zurück, setzte stattdessen auf obskure Mittel und Methoden der Selbstmedikamentation und war somit, wie viele seinesgleichen, selber Nagel zu seinem Sarg. Freilich wäre ohne seine Leiden sein Hauptwerk, der im Krankenbett entstandene Riesenroman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, nie entstanden. Ein chef d‘œuvre der französischen und Weltliteratur, Kolossalpanorama der hohen – dabei durchaus nicht zwingend guten – Gesellschaft während der im Ersten Weltkrieg ruinierten Belle Époque: zwischen vier- und sechstausend Seiten, je nach Ausgabe und Druckbild, in sieben Bänden – wer hats gelesen? Kann man, will man es? Man kann: Das beweisen die Sprachkunst-Enthusiasten, die mit Proust-Zitaten konversierend elitäre Zirkel bilden und nur von der „Recherche“ sprechen, nach dem Titel des Originals: „À la recherche du temps perdu“. Wie groß freilich, selbst unter unverdrossenen Literaturfreunden, die Zahl derer sein mag, die sich so verständig wie geduldig der Komplettlektüre dieses Prosahochgebirges aus dem Fin de Siècle aussetzen, das sei dahingestellt. Will man es lesen? Nicht jede und jeder will; und „sucht“ seine „Zeit“ anders, wenn schon nicht besser, zu investieren. Andere wollen lesen und tun es auch – finden aber keinen Gefallen an dem literarischen Monument. So gab am 10. Juli, dem 150. Geburtstag des Endlos-Erzählers, der Literaturwissenschaftler Robert P. Harrison in der Neuen Zürcher Zeitung unumwunden zu, noch „nach Jahrzehnten nicht zum Proust-Leser“ comme il faut geworden zu sein. Und in der Wochenzeitung Die Zeit, am selben Tag, räumte Jochen Schmidt, ein deutscher Schriftsteller („Schmidt liest Proust“), ein, auch ihm gehe die Schreibart des fabulierfreudigen Franzosen bisweilen gehörig „auf die Nerven“. Unbestreitbar bedarf es, um die „Verlorene Zeit“ zu bewältigen, eines großen Entschlusses und seiner disziplinierten Durchsetzung: Der Schreiber dieser Zeilen, der den Roman im Jahr 2007 während viereinhalb Monaten hartnäckig durchackerte, tats wahrlich oft genug mit Mühe. Das begann – ohne damit zu enden – schon damit, dass er als Journalist gelernt hatte: Überlange Sätze mit bis zu 521 Wörtern (in Eva Rechel-Mertens’ Übersetzung) können schlechterdings keine guten Sätze sein. Proust, der gefeierte Stilist – in Wahrheit Krankheitsursache für leidende Leser? Muss man ihn, als Bücher-Aficionado, wirklich gelesen haben? Sicher nicht, genauso wenig, wie man Musils „Mann ohne Eigenschaften“ gelesen haben muss, oder Joyces „Ulysses“, oder Thomas Manns Josephs-Tetralogie ... Verlorene Zeit freilich ist selbst die Lektüre solcher bis zur Adipositas dickleibiger und übergewichtiger Epen nicht. Mag sein, man liest sie nicht immer gern. Aber man hat sie gern gelesen. ■
Power in Pumps
Dienstag, 13. Juli Hierzulande gibt es sie im Design „Alice im Wunderland“ (verziert mit Mädchen und Häschen), aber auch „floral“ (dann obendrein vegan). Zudem werden Kampfstiefel den Damen, die es „im Frühling oder Herbst“ gern etwas wärmer vom Knie abwärts haben, mit besonders hohem Schaft offeriert. Militäraffine Frauen wissen sich also nicht unbedingt auf schmucklos-martialische Treter angewiesen, wie sie den Angehörigen der Bundeswehr verordnet sind. In den einheimischen Streitkräften tun derzeit gut 23 000 Soldatinnen Dienst – und gut daran, sich für den Einsatz mit festem Schuhwerk auszustatten. Eigens darum hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer neben neuen Kampfhosen, -westen und Helmen auch verbesserte Fußbekleidung angeschafft. Vergleichsweise ungeschickt verhielt sich hingegen AKKs ukrainischer Ressortkollege Stepan Timofijowitsch Poltorak: Auf sein Ministerium geht der ungewöhnliche Einfall zurück, bei einer für den 24. August anberaumten Militärparade zum Jahrestag der nationalen Unabhängigkeit ganze Kolonnen von Soldatinnen zwar im olivgrünen bis kakifarbenen, Camouflage-gemusterten Kampf-Outfit, aber auf Pumps staksend aufmarschieren zu lassen. In jener verblüffenden Anzugsordnung erkennt Olena Kondratjuk, stellvertretende Parlamentspräsidentin, eine sexistische „Demütigung“ der diensttuenden Frauen, worin ihr recht zu geben ist. Weniger glaubhaft erscheinen zahllose Facebook-Posts, die den Entscheidern gar ein „mittelalterliches“ Geschlechterbild vorwerfen, kamen doch Schuhe mit vergleichbar hohen Absätzen erst im siebzehnten Jahrhundert auf. Grundsätzlich mag es Gründe geben, im Interesse der Truppe neben einer Steigerung der Kampfkraft auch die Verbesserung ihrer modischen Erscheinung zu erwägen. Schon vor Jahrzehnten veröffentlichte der unvergessene Loriot alias Vicco von Bülow Vorschläge dazu. Der Zeit geschuldet, betrafen sie ausschließlich männliche Krieger; aus heutiger Sicht eignen sie sich noch viel mehr für Frauenpower unter Waffen. In Zeichnung und Text präsentierte der Autor eine „Kampfkombination in altrosa Baumwollrips. Das leicht angekrauste Beinkleid betont die Hüftlinie. Ein sportlich geschnittenes Oberteil mit Dreiviertelarm vervollständigt den jugendlichen Eindruck. Nabelfrei und mit knapper Popeline-Bluse eignet sich das St.-Tropez-Modell für Geländeausbildung an heißen Tagen. Aus jasminfarbenem Kunstseiden-Crêpe ist der kleine Abendanzug des Offiziersanwärters. In schlankmachendem Schrägschnitt fällt der Stoff weich von der Schulter, wo er durch eine Medaille gehalten wird.“ Zugegeben, in solcher Garderobe hätte sich der Schreiber dieser Zeilen, der vor über vierzig Jahren seinen Wehrdienst leistete, wahrscheinlich nicht recht wohlgefühlt; freilich tat ers ebenso wenig im eintönig-rauen „Grünzeug“, das ihn abträglich kleidete. Am meisten verabscheute er das „Schiffchen“, eine zwar weltweit verbreitete, aber bis zum Schwachsinn unpraktische Kopfbedeckung von beschämend lächerlichem Aussehen. Unbequem ferner: die im Freien wie im Innern der Kaserne zu tragenden Kampfstiefel – die waren hart und klobig, sorgten verlässlich für kalte Füße und machten beim Gehen unerwünscht viel Geräusch. Sehr wahrscheinlich bräche umgehend der Weltfrieden aus, wenn man den Soldatinnen und Soldaten alles Schuhwerk grundsätzlich vorenthielte. „Stell dir vor, es ist Krieg ...“: Barfuß geht da keiner hin. ■
Geist vs. Gewalt
Samstag, 10. Juli Das Buch spielt unter Deutschen in der deutschen Hauptstadt. Es spielt unter Juden, bevor und während sie in Deutschland so gut wie ausgerottet wurden. Das Buch, Gabriele Tergits „Effingers“, spielt unter Juden, die „assimiliert“ sind, „angeglichen“ also, „angepasst“, „eingegliedert“. Von Assimilation sprechen Biologen, wenn Organismen Nährstoffe aus ihrer Umgebung in sich aufnehmen, um sie sich als körpereigene Substanzen anzuverwandeln. Auf Menschen jüdischen Glaubens angewandt, hieße dies: Für ihre Existenz wäre ‚das Deutsche‘ im Grunde ein artfremdes Substrat. Wirklich grassiert zwischen 1878 und 1948, als das Buch spielt, der Antisemitismus immer krasser. „Ich gehöre zu einer verachteten Rasse und bin ein Bürger zweiten Ranges in Deutschland“, schreibt der Gelehrte Waldemar in einem Brief. „Aber ich bin durch meine bloße Existenz als Jude Zeuge für die Kraft des Geistes und der Gewaltlosigkeit. Die Synagoge des verfolgten Juden, dieses kleine, versteckte Stübchen, ist der letzte Rest der römischen Katakomben, der letzte Rest und Zeuge für jene Macht des Geistes, die Rom besiegte.“ Gleichwohl unterliegen die Effingers und ihre Verwandten der Gewalt: deutscher Gewalt. Zwar triumphiert der Geist der Freiheit am Ende über zwölf Jahre braunes Grauen, doch hat die industrielle Vernichtungswalze der Shoa die meisten Figuren des Buchs bis dahin zermalmt. Als es 2019 nach langer Zeit neu herauskam, waren sich die meisten Feuilletons einig: Mit der Wiederveröffentlichung des 1951 erstmals erschienenen – damals indes kaum beachteten – Romans hatte der Schöffling-Verlag einen Schatz gehoben. Ein „Epochenroman“, wenn auch keiner nach Art des musilschen „Manns ohne Eigenschaften“; oder vielleicht doch, irgendwie? Seine vielen sich über- und durchkreuzenden Geschehnisgänge spannen sich wie ein Netz über mehrere Familien und Generationen und über sieben deutsche Jahrzehnte aus. Als „jüdische ‚Buddenbrooks‘ “ wird der (inzwischen in der zehnten Auflage lieferbare) 900-Seiten-Schmöker erwartungsgemäß gern apostrophiert, erzählt doch die jüdische, 1982 gestorbene Autorin, wie Thomas Mann fünfzig Jahre vor ihr, vom „Verfall“ eines Kaufmannsclans. Freilich steht das Buch mit seiner Erfindungskraft und Nähe zur Geschichte, seiner menschlichen Haltung und literarischen Qualität frei für sich. Dieser Tage bekräftigte dies seine Herausgeberin, die Berliner Publizistin Nicole Henneberg, in Hof (wo sie, als Tochter des ortsansässigen Schriftstellers Claus Henneberg, 1955 zur Welt kam). Im Rahmen der Festwochen „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ stellte sie den Roman im Museum Bayerisches Vogtland vor: Wie die „Buddenbrooks“, sagt sie, schilderten „Effingers“ das „Zerbröckeln und Zerbrechen bürgerlicher Gewissheiten“ und die „Risse, die das innerhalb einer Familie hervorruft“. Der „eigentliche Held“ sei „die Zeit, weil sie die Figuren immer schneller vor sich hertreibt“. Im August lässt Henneberg „So war’s eben“ folgen, den letzten, vollends vor dem Hintergrund des Holocausts inszenierten Roman Tergits; ihr erster, „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“, liegt seit 2018 vor; ferner gibt es von ihr Erinnerungen, Gerichtsreportagen, Gartenbücher. „Tergit“, rühmte die FAZ, „ist Robert Musils Schwester im Geiste.“ Zum Glück nicht, möchte man einwenden: Sie liest sich weitaus leichter, dabei mit nicht weniger Gewinn. ■
Zwischen Sternen
Dienstag, 6. Juli In den Vereinigten Staaten leben fast 330 Millionen Menschen, um die sich die US-Regierung kümmern muss. Hinzu kommen so unsichere Kantonisten wie die gut 1,4 Milliarden Chinesen und die 145 Millionen Russen, mit denen nicht gut Kirschen essen ist, um von unleidlichen Iranern, Nordkoreanern und weiteren schlimmen Fingern nicht zu reden. Auf sie alle hat das mächtigste Land der Welt ein wachsames Auge – und muss zudem das andere in den Himmel richten, um die unendlichen Weiten des Weltraums abzusuchen. Denn wer weiß, wer oder was uns von dort droht, heimsucht oder nur beobachtet. Dass weder auf dem Mars noch auf der Venus kleine grüne Männchen hausen, bestätigen uns die Raumsonden, die wir umständlich und zeitaufwendig dorthin entsandten. An den Gedanken, dass auf Monden weiter entfernter Planeten unseres Sonnensystems, wahrscheinlich unter ewigem Eis, womöglich Formen primitiven Lebens umherschwimmen, gewöhnen wir uns zurzeit, wenn auch nicht leicht. Aber gestandene Außerirdische, wie in „Star Trek“, wie im „Krieg der Sterne“, kurios menschenähnlich oder gurken- oder fleischklopsförmig – an sie zu glauben weigern sich die meisten von uns, und aus gutem Grund. Zwar zweifeln wir besser nicht daran, dass es rund um die mindestens hundert Milliarden Fixsterne unserer Milchstraße, erst recht vielerorts in den mindestens hundert Milliarden Galaxien des Alls, Organismen gibt, die uns geistig zumindest ebenbürtig, wenn nicht uneinholbar überlegen sind. Was aber sollte sie dazu bewegen, Millionen Lichtjahre weit zu reisen, nur um bei uns hier vorzusprechen? Gleichwohl haben die Geheimdienste der Vereinigten Staaten eine Studie erarbeitet – und dieser Tage publiziert –, worin sie Ufo-Sichtungen nicht von Spinnern, sondern des Militärs nachgehen. Von 144 seit 2004 über den USA erfassten „Unbekannten Flugobjekten“ habe sich lediglich ein einziges als menschengemacht identifizieren lassen. Was die anderen betreffe, so sei die Verwechslung mit Weltraumschrott oder Meteoriten, Wetterphänomenen oder -ballons, Satelliten oder Vogelschwärmen, Drohnen, Kleinflugzeugen und dergleichen auszuschließen. Fast gleichzeitig veröffentlichten vier Astronomen der Pennsylvania State University das Ergebnis einer Computersimulation: Sie besagt, dass eine zu interstellarer Raumfahrt befähigte Spezies ein komplettes Sternensystem besiedeln könnte, und das verhältnismäßig rasch – binnen ein paar hunderttausend Jahren. Längst munkeln manche Medien genüsslich davon, 74 Jahre nach dem sogenannten „Roswell-Zwischenfall“ in New Mexico könnten geheime US-Behörden endlich greifbare Belege für reiselustige Technik-Genies from outer space besitzen. Sollte indes eine Zivilisation irgendwo im Weltall – so ultrahoch entwickelt, dass sie die unbeugbaren Naturgesetze von Lichtgeschwindigkeit, Zeit und Raum überwindet – ernstliches Interesse daran hegen, uns Erdlingen ihre Aufwartung zu machen, die wir noch nicht mal fertig darüber nachgedacht haben, wie wir zum zweiten Mal auf unseren nur 400 000 Kilometer entfernten Mond gelangen können? Aliens, in womöglich friedlicher Absicht unterwegs, um in der weiten Unendlichkeit des intergalaktischen Raums nach intelligentem Leben zu forschen, werden an unserer erschöpften Erde vorüberziehen, rasch begreifend: Hier ist nicht viel davon zu finden. ■
Standbildersturm
Samstag, 3. Juli Ein Pressefoto von starker Zeichenhaftigkeit: Mit einem Kran haben Soldaten der US-Army die Spitze des haushohen Denkmals erklommen. Um den Hals des Diktators, sechs Meter über dem Marmorsockel, legen sie ein dickes Tau, als wollten sie den Besiegten erhängen, während ein Zivilist des mehr oder weniger „befreiten“ Landes ein Sternenbanner im Wind, dem der Geschichte, flattern lässt. Gleich wird der Kranwagen das Seil mit einem Ruck anziehen, der bronzene Saddam Hussein wird sich steif neigen, an den Oberschenkeln brechen und krachend in den aufwirbelnden Straßenstaub des Bagdader Zentrums stürzen. Weniger eine spontane Aktion als ein sorgsam inszenierter symbolischer Akt: Das Foto vom 9. April 2003 aus der irakischen Hauptstadt sollte unwiderruflich demonstrieren, wie gründlich die Sieger aus dem wohlerzogenen Westen den orientalischen Tyrannen und sein System demontiert hatten. Was allerdings weniger leicht fiel als gedacht: „Saddam“, so spottete die Welt wenige Tage später, „leistete standbildhaft Widerstand.“ Besonders seit dem vergangenen Jahr machen etliche Orte auf Erden mit neuen Standbilderstürmen von sich reden. So ging es in den USA mehreren Monumenten an den Kragen, die Christoph Kolumbus glorifizierten: Der habe, so seine Gegner, Amerika nicht entdeckt, aber den Doppelkontinent dem Kolonialismus der Europäer und ihrer hemmungslosen Gewinnsucht ausgeliefert. Aus Gent wurde eine Gedenkbüste des Königs Leopold II. getilgt, unter dessen Herrschaft die Belgier den zentralafrikanischen Kongo und seine Bevölkerung grausam hatten bluten lassen. In Richmond verschwand das achtzehn Meter hohe Denkmal für den stolz auf einem Pferd thronenden südstaatlichen Bürgerkriegs-General Robert E. Lee, den Black Lives Matter-Aktivisten als Vorkämpfer für Rassismus und Sklaverei beschuldigen; es wurde in einem Museum versteckt. Selbst Regierungschefs der Vereinigten Staaten sind nicht sicher vor den einheimischen Geschichtskritikern: So wird, nach jahrelangen Protesten, der gleichfalls im Sattel sitzende Theodore Roosevelt, zwischen 1901 bis 1909 der 26. Präsident der Nation, demnächst von seinem Platz beim New Yorker Naturkundemuseum weichen und in einen Unterschlupf umziehen müssen: Menschenrechtler monieren, das Figurenpersonal rund um Ross und Reiter diskriminiere indigene Nordamerikaner und Afrikaner als unterwürfige Wilde. Auf diese Weise trifft zweifelhafte Politiker und Militärs – und nicht nur sie –, was schon die alten Römer als damnatio memoriae betrieben, als Versuch, missliebige Gestalten der Vergangenheit aus dem kollektiven Gedächtnis zu vertreiben. Freilich lässt sich durch solch äußerliche Taten der Ausmerzung die Erinnerung nicht austricksen – auch nicht die an Marilyn Monroe; gleichwohl forderte die Me too-Bewegung in diesen Tagen, die Installation Forever Marilyn – in der berühmtesten Pose der Hollywood-Ikone aus dem Film „Das verflixte siebte Jahr“, mit emporgewehtem Sommerkleid überm Gitter eines U-Bahn-Schachts – von ihrem Standort vor dem Kunstmuseum von Palm Springs zu entfernen: Die acht Meter hohe Statue sei sexistisch und geschmacklos. „Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler“, meinte der österreichische Schriftsteller Robert Musil – ein angenehm griffiges Diktum, das die manipulative Symbolkraft der Monumente freilich herunterspielt. Hätte Musil recht, so genügte es, einfach nicht hinzusehen. ■
Irgendwie echt
Dienstag, 15. Juni Wir stellen uns vor: In einer Ausstellung mit Werken Albrecht Dürers stehen wir versunken vor der weltbekannten „Melancholia“, bestaunen die Rätselhaftigkeit des Sujets, die Kunstfertigkeit der Ausführung, erschauern vor dem Halbjahrtausend, aus dem Meister und Kupferstich uns nahekommen, und freuen uns, der zahllos reproduzierten Grafik endlich im Original zu begegnen. Daheim indes desillusioniert uns der Katalog: Das Blatt, weil unbezahlbar und kaum zu versichern, sei uns dann doch wieder nur in Gestalt eines Scans, wenn auch unterschiedslos zum Urbild, präsentiert worden. „Nur“ eine Kopie? Dürfen wir uns unzufrieden und getäuscht fühlen, weil wir unsere Andacht an eine Fälschung verschwendeten? Die Aura des Bildes wirkte ja ungemindert auf uns. Die Symbolwelt, die sich vor uns auftat, war die dürersche, zu der niemand etwas hinzutat, wie auch keiner etwas fortnahm von ihr. 2018 ersteigerte ein Käufer das „Porträt des Edmond de Belamy“, das erste als Kunst ausgegebene Bildwerk, das nicht ein Mensch, sondern ein Computer erstellt hatte; den Wert setzte der Abnehmer fest, indem er bereit war, dafür 380 500 Euro zu bezahlen. Gesetzt den Fall, Pierre Fautrel, der den Algorithmus programmiert hat, druckt es dieser Tage ein weiteres Mal auf Leinwand aus: Existieren dann zwei Originale, weil beide bis zum letzten Pixel identisch sind? Und ist der Klon zwangsläufig ebenso viel wert wie das erste Exemplar? Klone, also gleichsam genetisch identische Kopien, von herausragenden Exponaten verbreiten zum Beispiel die Uffizien, weil der vielbesuchten Florentiner Sammlung coronahalber die Eintrittsgelder wegbrachen. Im Auftrag der Galerie stellte eine Spezialfirma neun digitale Duplikate von Michelangelos „Tondo Doni“ her, seinem weltberühmten Rundbild der Heiligen Familie von 1508. Ein Exemplar war einem Interessenten 140 000 Euro wert. Vor solchem Hintergrund verdient Walter Benjamins blickveränderndes Essay über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ erneute Lektüre und gesteigertes Interesse: Schon 1936 wies der Denker nach, wie Schöpfungen der Bild- und Tonkunst durch die Option, sie mittels Fotografie, Kunstdruck, Musikkonserve beliebig oft originalgetreu zu vervielfältigen, ihre auratische Ausstrahlung oder gar rituelle Bedeutung einbüßen. Umso mehr geht davon verloren, je näher wir die Repliken in unserer Nähe verfügbar halten. Die „Melancholia“ in der Dürer-Schau: Ist allein der uns vorenthaltene, fünfhundert Jahre alte ‚echte‘ Plattenabzug Kunst – und das uns gezeigte Blatt nichts als bedrucktes Papier? Seit Jahrzehnten kämpft sich der genieästhetische Begriff des Werks von einer Krise zur nächsten: So recht will namentlich die Literaturwissenschaft schon lange nicht mehr an ihn glauben, sieht sie doch jeden Text durch intertextuelle Bezüge in zahllose Kontexte verflochten; erst recht weiß heute, im Zeitalter des copy and paste und der digital art works, niemand mehr, was genau und wieviel der eine Autor oder die andere Künstlerin, wenn nicht der Computer zu einer Kreation beitrug. Mithin müssen, wie die Vorstellung vom Werk, auch Kategorien wie Original, Kopie, Fälschung neu gefüllt, vielleicht verworfen werden. Salvador Dalí, der an der Vielzahl seiner Nachahmer den eigenen künstlerischen Rang maß, ging da als Pionier voran: Blanko signierte er zigtausende Papierbögen; wer welche besaß, konnte ein paar eigene, autorisiert ‚echte Dalís‘ darauf pinseln, ganz nach Bedarf. ■
Smart history
Samstag, 12. Juni Die Reihen heißen i-Phone und Huawei, Samsung Galaxy oder Xiaomi … Und alljährlich kommt in jeder mindestens ein neues Modell heraus. Im vergangenen Jahr nutzten dreieinhalb Milliarden Menschen auf Erden ein Smartphone; das sind, bei knapp acht Milliarden insgesamt, rein rechnerisch fast 44 Prozent der Weltbevölkerung. Statistiker sagen voraus, in zwei Jahren würden 4,3 Milliarden der Taschencomputer in Gebrauch sein. Man entgeht der Technik nicht; sogar der Schreiber dieser Zeilen, noch vor einem halben Jahr davon überzeugt, sich nie im Leben eines derartigen Werkzeugs zu bedienen, trägt heute den früheren elektronischen Dauerbegleiter seiner Tochter auf und hat längst Blut geleckt an den famosen Möglichkeiten. Wenn je ein unternehmerischer Coup ins Schwarze traf, dann das Mobiltelefon. Solange die (von den Herstellern nach Kräften wachgehaltene) Nachfrage maßgeblich das Angebot bestimmt, wird die Edition immer neuer Typen mit noch futuristischeren Features nicht nachlassen. Pro Jahr kaufen sich gut eine Milliarde Nutzer ein neues Handy. Gefühlt müsste der globale Handymüll, jährlich aufgeschüttet, für ein deutsches Mittelgebirge reichen. Allein in jedem bundesrepublikanischen Haushalt liegen, einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe zufolge, durchschnittlich 3,1 Mobiltelefone einsatzfähig, aber ungenutzt herum. Wohin auch mit den alten Kästchen, deren Optionen immer rascher veralten? Rat weiß, unter anderen, die Website Ordnungsliebe. Also: Das gute, wenngleich angejahrte Stück einfach wegwerfen? Keinesfalls, enthält es doch – neben wertvollen, teils immer seltener werdenden Rohstoffen – auch giftige Substanzen, die nach Spezialentsorgung verlangen. Besser, man bringt es dorthin, wo es einst gekauft wurde, denn ein Gesetz verpflichtet zumindest große Elektronikmärkte, es kostenlos zurückzunehmen. Zudem freuen sich etliche Hilfs- und Umweltorganisationen über Handyspenden. Auch lässt sich manches Modell, sofern das allgemeine Interesse daran noch nicht ganz erlosch, verkaufen, entweder direkt und gegen bar, oder über spezielle Händler via Internet, oder über einen der gängigen Online-Marktplätze. Obendrein haben nun ein paar wenige Besitzer das Glück, ihre Altgeräte zu musealen Ehren kommen zu lassen. Weil nämlich vor bald 25 Jahren, am 15. August 1996, der Nokia 9000 Communicator auf den Markt kam – als erstes Mobiltelefon mit SMS- und Fax-Funktion sowie Internetzugang für unterwegs –, bereitet das Museum für Kommunikation in Frankfurt eine Ausstellung vor, die genau am Jahrestag eröffnet werden soll. „Smartphone.25 – Erzähl mal!“ heißt das Projekt; erzählen sollen Menschen, die alte Handys und Smartphones einsenden. „Wir suchen im Idealfall ganze Gerätereihen, die von einem Menschen im Lauf der Zeit benutzt wurden“, sagt Kurator Joel Fischer, „um die unglaubliche Funktionserweiterung wie Foto-Apps oder Whats-App erkennen zu lassen.“ So wie auf die Geräte freue man sich auf die dazugehörigen „smart stories“. Von denen bildet jede einzelne eine heimliche Episode der smart world history – denn die Erfindung des Handys, zumal des Smartphones, hat global und unumkehrbar zu einem Paradigmenwechsel geführt, der den oft überstrapazierten Namen verdient: zu einem von Grund auf gewandelten Umgang der Individuen miteinander, zu einem schier grenzenlos geweiteten Blick auf die Dinge der Welt. ■
Halbes Vergnügen
Dienstag, 8. Juni Vor einer Woche Verdis „Aida“, globaler Publikumsmagnet der Musikbühnen. In einer Woche was für Raritätensammler: „Der Dämon“, eine hierzulande weitgehend unbekannte Oper des Russen Anton Rubinstein, das als „Meisterwerk“ zu bezeichnen der Bayerische Rundfunk gleichwohl nicht ansteht. Fast jede Woche, samstags ab 19.05 Uhr, ist der Münchner Sender den Geduldigsten unter seinem klassikaffinen Hörvolk mit einem „Opernabend“ dienlich. Mitschnitte und Liveübertragungen aus großen Häusern überall auf der Welt reiht er in beachtlicher Zahl und Güte aneinander, Dvořáks „Rusalka“, zum Beispiel, kam kürzlich aus der New Yorker Met, demnächst, am 26. Juni, steht Wagners „Parsifal“ aus Wien an. Wer wollte da meckern, wenn er sich zu Hause zwischen den Lautsprecherboxen gemütlich macht oder die Kopfhörer über die Ohren stülpt. Bequemer gehts nicht, wo man doch im Privatissimum das klangvolle Drama noch dazu mit einem Glas Rotwein oder Bier, einem Krabbensalat oder einer Wurstsemmel, geschniegelt oder unfrisiert, im Anzug oder in der Jogginghose genießen kann – ad libitum, wie es in der Musik heißt: ganz nach Belieben. Nun hat aber, wer eine Jogginghose trägt, dem unvergesslichen Diktum des ebensolchen Karl Lagerfeld zufolge „die Kontrolle über sein Leben verloren“, und ebenso muss, wer Musiktheater ohne Theater konsumiert, bereit sein, den kontrollierenden Blick auf Dramaturgie und Regie der lebendigen Bühne auszublenden. Dennoch ist Operngesang aus der Konserve so alt wie die Erfindung des Tonträgers und Oper im deutschen Radio (beinah) so alt wie das deutsche Radio selbst: Vor jetzt hundert Jahren, am 8. Juni 1921, ging mit Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“, aufgenommen in der Berliner Staatsoper, erstmals ein vollständiges Musikdrama über den Äther der Weimarer Republik. Der Sender Königs Wusterhausen, südlich von Berlin in Brandenburg gelegen, strahlte es versuchsweise aus. Seit Weltkriegsbeginn 1914 hatte es dort eine militärische Funkstation gegeben, die im Frieden an die Reichspost übergegangen war. Nach ersten Experimenten mit dem Rundfunk intonierten zu Beginn des Jahres 1920 Techniker mit Klarinette, Violine und Violoncello Kammermusik, die sich noch in zweitausend Kilometern Entfernung gut empfangen ließ. Am 22. Dezember folgte, versteht sich, ein Weihnachtskonzert unter zusätzlicher Beteiligung von Postlern, die christfestliche Lieder anstimmten. Nun war alle Skepsis gebrochen: Aus dem Ausland gingen begeisterte Dankesschreiben gerührter Hörerinnen und Hörer ein; jedoch war im Reich selbst privates Radiohören noch untersagt und streng strafbewehrt, was sich erst 1923 änderte. Beide Erfolgsgeschichten, die Brandenburger und die Münchner, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Oper im Radio stets ein halbes Vergnügen bleiben muss: Neben der nur ungern entbehrten Atmosphäre öffentlicher Theaterbetriebsamkeit und der Gemeinschaft eines Stuhl an Stuhl sitzenden Publikums fehlt notgedrungen, was im Kern die Welt der Bühne ausmacht: Es fehlen die Bilder und das Spiel. Dafür hat man in den Ohren Stars zu Gast: Jonas Kaufmann etwa als Parsifal oder Radames, Renée Fleming als Rusalka, oder, am Nürnberger Dirigentenpult, Joanna Mallwitz … Immerhin. Karten für derlei Galavorstellungen wird sich wöchentlich ohnehin kaum jemand leisten, und Bier und Wurst finden sich im Kühlschrank fast für lau. ■
Fast geschenkt
Samstag, 5. Juni Außer Verpackungsmaterial und der Zeitung von gestern veralten wenige Papierprodukte so schnell wie eine Eintrittskarte. Die Kartonagen jüngst empfangener Pakete mit ihren polsternden Schnitzeln oder Fetzen bewahren wir unter Umständen wochenlang auf, für den Fall, dass Rücksendungen nötig werden. Unserem Lokalblatt geben wir, bevor wir es umweltgerecht entsorgen, zwei oder drei Tage, weil vielleicht noch Familienangehörige, Nachbarn oder Untermieter die Todesanzeigen, Sportseiten oder das Restfeuilleton studieren wollen. Aber das Ticket eines Freibad- oder Kino- oder Zoobesuchs überdauert in der Regel keine zehn Minuten nach dem Ende des Vergnügens; meist noch am Ausgang werfen wir es in den Müll. Weil aber manche Zeitgenossen so gut wie alles sammeln – Kugelschreiber (eine Dame in Dinslaken, über 220 000 Stifte) oder Tierpenisse (ein Isländer, 300 Präparate), verbrannte Lebensmittel (ein Museum in Massachusetts, 49 000 Exponate) oder Fusseln aus dem Bauchnabel (ein Australier, seit 26 Jahren) –, gibt es unter unseren Nebenmenschen auch solche, die sich von alten Eintrittskarten nicht trennen mögen. Taugen die doch als Gedächtnis für wertvolle Erlebnisse, wenn nicht überwältigende Augenblicke. Sie können etwas, das zum Beispiel zig jahrzehntealte Burger (gehortet von Matt Malgram) oder viertausend leere Zahnpastatuben (von Ronan Jordan, beide in den USA) nicht können. „Tickets aus Papier wecken bei vielen Menschen Erinnerungen: an große sportliche Triumphe oder Niederlagen, an Reisen in ferne Länder mit anderen Kulturen“, schrieb dieser Tage das Haller Kreisblatt, eine kleine Lokalzeitung in Westfalen, und rief seine Leserinnen und Leser zur „Suche nach Ihrer schönsten Eintrittskarte“ auf. Mit gutem Beispiel geht Sportredakteur Dennis Bleck voran, denn er „hat seine Lieblings-Eintrittskarten gerahmt und im Wohnzimmer an die Wand gehängt und kann zu jeder eine spannende Geschichte erzählen“. Um solch eine Legende reicher werden all jene sein, die am 26. Juni in Florida ein Konzert der Punkbands Teenage Bottle Rocket, Make War und Rutterkin besuchen sollten, ohne vollständig gegen das Corona-Virus geimpft zu sein. Wären sies, müssten sie einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP zufolge lediglich achtzehn Dollar für den Abend in der Küstenstadt Saint Petersburg berappen. Das ist fast geschenkt, denn ohne einschlägigen Nachweis kostet sie das Ticket 999 Dollar und 99 Cent. Der Veranstalter Leadfoot Productions teilte mit, gerade jetzt, wo die Nachfrage nach Impfungen in den Vereinigten Staaten sinke, zugleich aber viele Menschen endlich wieder in Konzerte drängten, wolle man verstärkt für Sicherheit sorgen. Die Hauptband Teenage Bottle Rocket solidarisierte sich: „Wir haben uns impfen lassen“, sagt Sänger Ray Carlisle in einem Facebook-Video, „und würden uns freuen, wenn ihr das auch tätet. Sicherheit geht vor – Party geht vor!“ Bisher wurde kein einziges Tausend-Dollar-Ticket verkauft. Inzwischen teilte Jan-Christian Dreesen, in München stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, mit, der Verein werde von der Saison 2021/22 an für die Spiele in der Allianz-Arena keine gedruckten Einlassdokumente oder Plastikkarten wie Papier- oder die Chip-Jahres-Tickets mehr anbieten: „Das ist ein wertvoller Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung.“ Wer weiß, vielleicht kauft uns irgendwann mal ein Sammler eine alte Bayern-Eintrittskarte ab, für 999 Euro und 99 Cent. ■
Der Dieb Nr. 1
Dienstag, 1. Juni Das Jahr 1896 überrascht uns grundsätzlich mit Geschwindigkeitsrekorden wie auch als Ursprungsmoment langfristiger Entwicklungen. So haben wir zwar den Krieg der Briten gegen das Sultanat auf der ostafrikanischen Insel Sansibar am 27. August als den wohl kürzesten der Weltgeschichte zu vermerken (er dauerte knappe 38 Minuten). Umso länger indes sehen wir, zum Beispiel, die im April desselben Jahres ausgetragenen ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit in Athen nachwirken: Immerhin zum 33. Mal soll sich heuer, vom 24. August bis zum 5. September, die „Jugend der Welt“ in Tokio zum globalen Sportfest treffen. Auch aus der Frühzeit motorisierter Fortbewegungsmittel ragt die Jahreszahl 1896 wegweisend heraus. So rief am 15. Januar der Pariser Automobilclub die erste Kfz-Vermietung ins Leben; zwar ging die überwiegende Mehrheit unserer Vorfahren damals noch lange mit der bewährten Eisenbahn auf Reisen, doch die Neugier wuchs – so mancher wollte die pferde- und dampfmaschinenlosen Kutschen wenigstens mal ausprobieren. Nicht sofort konnten sich Fußgänger wie Fahrzeugführer mit der zunehmenden Alltäglichkeit des Automobils arrangieren. Am 17. August des Jahres erlag auf einer der – ohnehin heillos überfüllten und verstopften – Straßen Londons Bridget Driscoll einer Kopfverletzung, die sie sich beim Sturz vor einen „Roger-Benz“ zugezogen hatte; mit einem Kotflügel hatte das Fahrzeug die 44-Jährige zu Boden geworfen – das erste verbürgte Todesopfer eines Autounfalls. Der Fahrer Arthur James Edsall, der vor dem Zusammenprall mit stolzen sechs Stundenkilometern dahergebraust war, ging straffrei aus. In keinem kausalen Zusammenhang steht die Tragödie mit dem Umstand, dass der französische Hersteller des Kraftfahrzeugmodells die Produktion im selben Jahr einstellte. Indem wir Edsalls Tempo heute als nicht sehr sportlich und schon gar nicht olympisch belächeln, sehen wir die Redensart bestätigt, der zufolge Geschwindigkeit „keine Hexerei“, sondern etwas Selbstverständliches ist. Zugleich aber sollte uns die sehr irdische, sehr schleppende Londoner Unglücksfahrt nicht glauben lassen, die Behörden hätten nicht bereits damals auf der Einhaltung strafbewehrter Straßenverkehrsverordnungen bestanden. Auf den 28. Januar 1896 fällt die erste Verurteilung eines Autofahrers wegen zu schnellen Fahrens. Der Teufelsritt mit sage und schreibe dreizehn Kilometern pro Stunde hatte wenige Wochen zuvor einen englischen Wachtmeister im Dorf Paddock Wood auf den Plan gerufen: Er brachte den Raser, einen Geschäftsmann, vor Gericht, das ihn zu einer Geldstrafe verdonnerte; bestimmte doch das britische Gesetz damals jeden Lenker, seinem Auto einen Läufer mit einem warnenden Fähnchen vorausspurten zu lassen, dessen Sauseschritt nicht getoppt werden durfte. Um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert konnte man die Fahrerlaubnis noch nicht einbüßen – wohl aber den Wagen selbst, und so bietet das Jahr 1896 denn auch den ersten dokumentierten Autodiebstahl aller Zeiten auf: Am 1. Juni, mithin vor genau 125 Jahren, riss sich ein Mechaniker in Paris den Peugeot eines Barons unter den Nagel; allerdings wurde der Ganove kurz darauf verhaftet, das Fahrzeug zurückerstattet. Bereits zwei Jahre zuvor übrigens hatte das erste internationale Autorennen stattgefunden: Paris-Rouen, 127 Kilometer in zehn oder mehr Stunden (einschließlich Mittagspause). Dabei sein war alles, wie bei Olympia. Ob man ins Ziel kam, stand in den Sternen. ■
Um die Wurst
Samstag, 29. Mai Wenn es um Heimat geht, gehts um die Wurst. Denn sie ist ein Wert für sich. Für viele von uns war oder ist – und bleibt vielleicht sogar – das Elternhaus Heimat oder der großväterliche Garten der Kindheit oder die Muttersprache. Flüchtende und Vertriebene erfahren schmerzlich, dass man die Heimat erst eigentlich erkennt, wenn man sie verliert. Weniger in der Gegenwart entsteht sie als aus Erinnerungen, sie ist nicht so sehr Ort wie Gefühl, nicht das Gegenteil von Feindesland, aber von Fremde. Auch allen möglichen Unsinn können wir für Heimat halten: unser erstes Auto oder unser jetziges, unseren Hobbykeller, das Sportvereinsheim, die Gesammelten Werke unseres Lieblingsautors. Ein Mensch kann zur Heimat werden, ein alter Teddybär. Ein Geräusch, Geruch, Geschmack. Eine Lieblingsspeise. Vor zwei Wochen machte die Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel zum Thema Heimat mit einem großen Foto prall baumelnder Bratwürste auf. Für allen möglichen Unsinn gibt es extra Museen, für Nachttöpfe (in Wasbüttel) und Säcke (Nieheim), Korkenzieher (Vogtsburg im Kaiserstuhl) oder Fingerhüte (Creglingen) – warum musste ein für Millionen von Menschen unverzichtbares Grundnahrungsmittel wie die Bratwurst so lange warten, bis ihm eine würdige Dauerausstellung eingerichtet wurde? Warum 2600 Jahre lang? So weit nämlich, ungefähr, liegt die erste gleichsam urkundliche Erwähnung der Bartwurst zurück; dabei findet sie sich in einer der seit eh und je vielgelesenen Ur- und Grundschriften der Weltliteratur: In der „Odyssee“ teilt der griechische Dichter Homer das früheste erhaltene Rezept mit, wonach die Bratwurst Fett und Blut enthält, gepresst in die Mägen von Ziegen und Schweinen, und triefend und glänzend über Kohlenglut zubereitet wird. Ums Jahr 50 nach Christus strich der römische Dichter Petronius die Exklusivität der Köstlichkeit dadurch heraus, dass er ihr in einem seiner Werke einen Rost aus gediegenem Silber unterschob. Vor 700 Jahren entstand das erste „Bratwurstglöcklein“ in Nürnberg (von wo sich Goethe später, um 1800, die „vorzüglich gefertigten Würstchen mit Majoran“ nach Weimar liefern ließ). Aus dem Jahr 1498 erhielt sich eine Art Speisekarte, die eine Coburger Bratwurst aufführt. Bereits auf einem Dokument von 1404 aus Arnstadt entzifferte ein Archivar die bis heute älteste Nennung der Thüringer Variante. Kein Wunder, dass ihr 600. Geburtstag 2004 in Erfurt groß gefeiert wurde. Zwei Jahre später, am 28. Mai 2006 und also vor jetzt fünfzehn Jahren, öffnete im Flecken Holzhausen im thüringischen Ilm-Kreis das erste Bratwurstmuseum der Welt seine Pforten. Endlich. Ein Freundeskreis vergibt dort einen Bratwurstpreis „an Personen, die sich in besonderer Weise um Thüringens leckerstes Kulturgut verdient gemacht haben“. Dergleichen versteht sich, in der hingebungsvoll vereinsmeiernden und ehrungsverliebten Republik, beinah von selbst. Als weit ungewöhnlicher hingegen fällt der Kontakt auf, den die Brät-Rolle im Örtchen zur darstellenden Kunst hält: Im „Bratwursttheater“ des Museums führt, seiner Website zufolge, „Hans Wurst gutmütig, aber auch respektlos“ durch eine „aktionsgeladene Posse, selbstverständlich mit Happy End“. Das Theater als solches, ob komisch oder tragisch, ob mit glücklichen oder schlimmstmöglichen Wendungen, ist etlichen von uns seit früher Jugend zur mindestens zweiten Heimat geworden. Freilich ließen sich manche Inszenierungen leichter ertragen mit einer Wurst in der Hand und zwischen den Zähnen.■
Über Abgründen
Diebstag, 25. Mai Als Flugmaschinen noch nicht erfunden waren – also während 99,99… Prozent der Geschichte – standen uns Menschen nur zwei Möglichkeiten offen, einen Abgrund zu überwinden: über Brücken, die uns von Rand zu Rand geleiten, oder auf dem Wasser, das die Kluft auffüllt und uns auf seinem Spiegel trägt. Stets bleibt das tiefe Unten ein Faszinosum, das unsere Fantasie beschäftigt, ein Jenseits, das uns schaudern macht und doch zu sich hinab zu locken scheint, ein Wunderland des Unbekannten. Als am 4. Juli 1862 die zehnjährige Alice Liddell in einem Boot auf den Wellen der (heute bis zu zwanzig Meter tiefen) Themse schaukelte, erbat sie sich von ihrem erwachsenen Begleiter Charles Lutwidge Dodgson eine Geschichte. Folgsam begann er, vor seiner Passagierin die unglaublichen Erlebnisse einer Altersgenossin mit ihrem Vornamen auszuspinnen: Ein Kaninchen in sein Erdloch verfolgend, gelangt sie unversehens in ein unterirdisches Abenteuerreich voller kurioser Begegnungen. Dem Fabuliermeister – der eigentlich Mathematiker, aber literarisch sehr belesen war – gerieten seine Improvisationen derart fesselnd, dass er, von der Zuhörerin gedrängt, sie niederschrieb: So erschuf er, fast durch Zufall, „Alice im Wunderland“. Das Manuskript reicherte er mit gefälligen Illustrationen an, und für sich selbst heckte er gleich noch ein Pseudonym aus. Als Lewis Carroll hält er seither in der Weltgeschichte der fantastischen Kinder- und Jugendliteratur einen Spitzenrang. Denn seine Erzählungen und ihre Fortsetzungen überwanden Sprachklüfte und Ozeane, um sich in Millionen Büchern, später auch auf der Bühne und im Kino rund um den Erdball zu verbreiten. Den tiefen Graben zwischen Realität und Imagination können seit Kurzem die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher des Londoner Victoria & Albert Museum überspringen – durch einen eigenen „wunderbaren Sturz in den Kaninchenbau“, wie der Guardian schrieb. Bunt und prall gefüllt beleuchtet die Ausstellung „Alice – Curiouser and Curiouser“ den Stoff von seinen Ursprüngen vor 159 Jahren an über alle erdenklichen Verwandlungen bis hin zu spektakulären Neuschöpfungen, wie das Museum auf seiner Website verspricht. Dokumentiert wird also die Rezeptionsgeschichte des Klassikers „vom Manuskript bis zum von allen Altersgruppen geliebten Phänomen“. Jenes Wort, vom griechischen phainómenon abstammend – sagt in diesem Fall alles: Es bezeichnet etwas Erscheinendes – mithin ein Ding, das wir durch Augenschein als Tatsache erkennen, wie auch ein anderes, das uns täuscht, weil es nicht ist, was es zu sein scheint. Zudem lässt uns der Begriff mit etwas Bemerkenswertem, weil Außergewöhnlichem rechnen. Jene Attribute dürfen wir uneingeschränkt dem jüngsten Großwerk anheften, mit dem der berühmte Streetart-Künstler JR alias Jean René zurzeit Paris in Aufregung versetzt: Auf der Freifläche des Trocadero, dem Eiffelturm gegenüber, installierte er eine Collage aus Schwarz-Weiß-Fotografien, die den schockierenden Eindruck erwecken, die Erde habe sich weit und tief geöffnet, sodass zwischen dem Aussichtsplatz und dem hauptstädtischen Wahrzeichen nun ein „Grand Canyon“ klaffe. Immer wieder: Stücke vom Wunderland. Es ist, als ob Teile der Welt nicht zusammenpassten, und doch vermitteln sie den Anschein, ein Ganzes zu ergeben. Fantasten und Illusionisten nennens Zauberei, Nervenärzte sagen Psychose oder Halluzination dazu, Künstler Poesie. ■
Kluges Grünzeug
Samstag, 22. Mai Endet die Seuche? Dürfen wir bald wieder kräftig zugreifen? In der Natur durften wirs noch nie. Zeichenhaft steht dafür das Springkraut, botanisch Impatiens noli-tangere: Wer im Sommer nach der reifen Pflanze grapscht, darf mit einem Aha-Erlebnis rechnen – ihm fliegen die unter gleichsam hydraulischem Druck stehenden Samen um die Ohren. Als Rühr-mich-nicht-an kennt der Volksmund das explosive Grünzeug; ein Name, der als Devise der Corona-Pandemie gelten kann. Zwar fallen allerorten die Fallzahlen, die Impfquote, umgekehrt, steigt, und schon hoffen wir, bald wieder in Scharen zusammentreffen zu dürfen. Doch das Virus existiert, schadet und mutiert weiter unter uns, weswegen wir aufs tägliche „AHA“ nicht verzichten dürfen: Atemmaske, Hände waschen, Abstand. Längst erschrecken wir, sobald sich in einem Fernsehfilm zwei die Hände schütteln oder gar umarmen. Gerade nut dem Distanzgebot und Berührungsverbot, so scheint es, haben sich viele – und allemal die Vernünftigen – unter uns abgefunden, dabei handelt es sich gerade um jene Regel, die unserer sozialen, durch Jahrhunderttausende ererbten Natur wohl am striktesten zuwiderläuft: unserem angeborenen Bedürfnis nach enger Fühlung und unmittelbarem Austausch. So tief in uns liegt die Sehnsucht nach Nähe und Kontakt, dass Mythen, Riten, Glaubensüberlieferungen sie spiegeln. So berichtet das Johannes-Evangelium der Bibel, wie Maria Magdalena freudig den auferstandenen Jesus an sich drücken will – und zurückgewiesen wird: „Rühre mich nicht an!“, unter humanistisch Gebildeten sprichwörtlich geworden als Noli me tangere. Das letzte der Wörter enthält die Wurzel für unser Wort Kontakt: Es stammt von con, lateinisch für zusammen, und tangere, für anfassen, her und ist ein starkes Wort – beschreibt es doch unser urmenschliches Verlangen danach, nestwarm beieinander zu hocken, Körper an Körper zu spüren. Allerdings genossen während langer Perioden unserer Vergangenheit Mädchen und junge Frauen gesellschaftliuche Achtung, wenn sie in einem gewissen Sinn „unberührt“ blieben, sich als Jungfrau „rein“ und „unbefleckt“ hielten von maskuliner Brunst. Umgekehrt bescheinigten Männer einander, ganze Kerle, wenn nicht Helden zu sein, sofern sie als Haudraufs kräftig zuzulangen wussten. Im Kino unserer Tage kommen waschechte Jungfrauen – und keusche Knaben – nur mehr selten vor und im Augenblick gar nicht: Seit einem halben Jahr bleiben in den Lichtspielhäusern die Leinwände dunkel. Gleichwohl besteht immerhin für die Trickfilm-Branche Grund zur Freude: Ihr mache Covid-19 kaum zu schaffen, ließ Ulrich Wegenast, Geschäftsführer des Internationalen Trickfilmfestivals in Stuttgart, wissen. Von „vollen Auftragsbücher“ vieler Studios berichtete er und betonte, dass manche sogar „händeringend Mitarbeiter“ suchten. Vielleicht beruht solcher Boom auch darauf, dass im Animationsfilm die Figuren, egal ob Normalmenschen oder Superhelden, Mammuts oder sprechende Autos, miteinander anstellen können, was sie wollen – in ihrer computergenerierten Welt treten kein Keim und keine Quarantäne störend zwischen sie. Gleichzeitig symbolisieren die verödeten Kinosäle die sich ausbreitende Leere zwischen vielen Mitmenschen, die einander vor Corona nahestanden. Wer nicht gern telefoniert und nicht auf die sozialen Netze schwört, droht zu vereinzeln und seinen Freunden (jenen, die nicht nur Facebook-„Freunde“ sind) verloren zu gehen. Aber auch zu diesem Umstand erteilen uns beliebte Pflanzen klugen Rat: Vergissmeinnicht, und zwar Jelängerjelieber. ■
In der Box
Dienstag, 18. Mai Sein Gesamtwerk kam in den Siebzigerjahren, als der Schreiber dieser Zeilen sich brennend für Literatur zu interessieren begann, gediegen wie in einer Klassikerausgabe daher. Folgerichtig in klassischen Versalien stand „Das Gesamtwerk“ auf dem Band (es war nur einer, denn das Œuvre des Dichters war notgedrungen klein geblieben). Darüber hinaus zeigte der weiße Schutzumschlag die schwebende Silhouette eines nackten Jünglings mit einer Leier: ein Poet, unschuldsrein. Dabei war Wolfgang Borchert gar nicht so weltentrückt ätherisch; „früh gereift und zart und traurig“, wie vor ihm ein anderer junger Dichter von sich geschrieben hatte, das war allerdings auch er. Indes enthielt das „Gesamtwerk“ nicht alles, was Borchert zu schreiben vergönnt war; weswegen es später, wie bei Klassikern üblich, einen Band mit Arbeiten „aus dem Nachlass“ gab. Auch ihn erwarb der Schreiber dieser Zeilen: „Die traurigen Geranien“ hieß das noch schmalere Buch, der Umschlag der Taschenausgabe zeigte eine Topfpflanze als weiße Silhouette auf schwarzem Grund. Nebeneinandergelegt, offenbaren beide Bände eine Differenz, vielleicht eine Dissonanz. Zwar, das Schaffen eines wichtigen Schriftstellers präsentierte der Rowohlt-Verlag in sorgfältiger Edition und hob den Dichter dadurch mit vollem Recht als eindrucksvolles, zudem tragisches Exempel deutscher Nachkriegsliteratur gleichsam auf einen Denkmalssockel. Andererseits stand Borchert gerade für die Abkehr von einer diskreditierten literarischen Klassizität und für den Aufbruch in Neues, für eine helden- und schlackenlose Dramatik und eine an der US-amerikanischen short story geschulte Erzählweise. Letzterer folgte er vorbildlich mit Kurzgeschichten wie „An diesem Dienstag“ oder „Nachts schlafen die Ratten doch“. Dem Theater lieferte er mit seinem auch heute noch gespielten Hauptwerk „Draußen vor der Tür“ einen ‚modernen Klassiker‘ zu. Ein wuchtiges, dabei subtiles Stück „Trümmerliteratur“: Stilisiert erzählt es die Geschichte des Autors. Der war vor hundert Jahren, am 20. Mai 1921, in Hamburg geboren worden und aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer ausgewachsenen Belastungsstörung zurückgekehrt. Von den Fronten will im Schauspiel auch der Landser Beckmann heimkehren, doch sein Zuhause liegt in Schutt und Asche. Wie Millionen andere ist er ein Gefallener des Krieges, nur dass er am Leben blieb. Beladen mit Leid und Schuld, sucht er nun nach einer übergeordneten Instanz, die ihm die „Verantwortung“ für all das Furchtbare abnimmt. Aber sein alter Oberst lässt ihn abblitzen, auch sonst findet er keine Hilfe, schon gar nicht bei Gott, „an den keiner mehr glaubt“. 25 Jahre alt ist der Beckmann des Stücks und schon ein „Greis“, ein Trauma auf strauchelnden Beinen. 26 Jahre alt war Borchert, als er krank in Basel starb, am Tag vor der Uraufführung seines Meisterwerks. Wie häufig bei großen Autorinnen und Autoren, lässt sich auch sein „Nachlass“ nicht in einem schmalen Taschenbuch fassen: Die Hamburger Ausstellung „Dissonanzen“ zeigt zurzeit in einer aus zwei Räumen der Staats- und Universitätsbibliothek bestehenden „Borchert-Box“ persönliche Habseligkeiten des Dichters, Bücher aus seinem Besitz und seine Pfeife samt Tabak, Modellschiffchen, Globus, Pulswärmer ... eine Küchenuhr. Genau so eine ist in Borcherts nach ihr benannter Kurzgeschichte während einer Bombennacht kaputtgegangen; nun zeigen ihre Zeiger starr eine Vergangenheit an, in der alles besser war. Alles ist besser als Krieg. ■
Alte mæren
Samstag, 15. Mai Dies alte Werk, eines der legendären der deutschen Literatur, verdankt sich vielfältiger mythischer Überlieferung; seinerseits hatte es, weil viele Bruchstücke aus älteren Quellen darin gleichsam neu geboren wurden, das Zeug dazu, einen eigenen Mythos zu begründen; obendrein darf man seine bloße Existenz ‚mythisch‘ nennen, im Sinn von staunenswert, unerklärlich, märchenhaft. Denn das Nibelungenlied war irgendwann ums Jahr 1200 ‚einfach da‘, als eine Art anonymen Librettos; offenkundig diente es nämlich dazu, von Rezitatoren halb sprechend, halb singend kunstvoll vorgetragen zu werden. Andere Dichtungen jener Jahre, etwa der „Arme Heinrich“ und der „Iwein“ des Hartmann von Aue oder die Lieder und Sprüche des Walther von der Vogelweide, Wolframs „Parsifal“ oder „Tristan und Isolde“ des Gottfried von Straßburg, blieben nicht allein durch ihre Titel und Titelhelden, sondern auch durch ihre namhaften Verfasser berühmt; hingegen blieb der Dichter des Nibelungenlieds bis heute unbekannt – vielleicht wars ein hochbegabter Kleriker aus dem Passau-nahen Donauraum, der mit dramatischer Buntheit, poetischem Tiefsinn und vielschichtiger Psychologie zu Werke ging. Alles ziemlich mirakulös – und so beginnt die Saga ja auch, mit Versen, die den meisten schon im Deutschunterricht begegnen: „Uns ist in alten mæren / wunders vil geseit // von helden lobebæren, / von grôzer arebeit, // von fröuden hôchgezîten, / von weinen und von klagen, // von küener recken strîten / muget ir nu wunder hœren sagen.“ Auch jemand, den mittelhochdeutsche Dichtung sonst nicht tangiert, kann sich gefangen genommen fühlen vom sagenhaft raunenden Ton, der Musikalität und Rhythmik gleich jener ersten Strophe, die zeitgemäß (und weniger melodiös) so lautet: „Uns wird in alten Erzählungen / viel Wunderbares mitgeteilt // von ruhmreichen Helden, / großer Mühsal, // von glücklichen Tagen und Festen, / von Tränen und Klagen. // Vom Kampf kühner Recken / könnt Ihr jetzt Erstaunliches erfahren.“ Ungefähr 2400 Strophen, je nach Handschrift, sinds insgesamt, jede zu vier in der Mitte geteilten Reimversen – macht alles in allem etwa 350 moderne Buchdruckseiten: eine Erzählung in epischer Breite. Als „Nationalepos der Deutschen“ ging sie denn auch hierzulande in die oft chauvinistisch, wenn nicht völkisch motivierte Literaturgeschichtsschreibung ein. Dabei hat der zur Zeit der sogenannten Völkerwanderung spielende Stoff „mit der deutschen Geschichte gar nichts zu tun“, wie der renommierte Frankfurter Mediävist Klaus von See unterstrich, werden doch „Zwist und Mord im burgundischen Königshaus“ verhandelt, also in linksrheinisch- französischen Gebieten an der Rhone; im zweiten Teil dann mündet das Geschehen bei den Hunnen des heutigen Ungarns in ein Blutbad. Zurzeit lädt die Badische Landesbibliothek im Internet zu einer großartigen „Schatzsuche“ rund um die älteste erhaltene Überlieferung des Liedes ein. So umfangreich, detailliert und spannend geriet die virtuelle Schau , dass ihre vier Teile mehr als einen Besuch verdienen. Dann erschließt sich wunders vil über die Saga und ihre Heimat im Mittelalter, ebenso werden die wenig lobebæren Verhunzungen durch spätere Ideologen deutlich, etwa die Parole von der „Nibelungentreue“ der Kaiserreiche im Ersten Weltkrieg oder die alte mære vom „Dolchstoß“ in den Rücken der deutschen Frontsoldaten, nachdem auch sie in den Blutbädern von 1914/18 schmählich hatten untergehen müssen, angeblich „unbesiegt“. ■
Sie sind mehr
Dienstag 11. Mai Man stelle sich wenigstens mal vor, im Sommer würde wirklich alles besser, Corona macht schlapp, Millionen blasser, angedickter Menschen können immerhin ein bisschen von dem machen, was sie schon längst wollen, zum Beispiel vom Start der neuen Kultursaison Ende September/Anfang Oktober weg endlich wieder ins Theater gehen und ins Kino, ins Konzert und ins Museum … Dann, ja dann, am 12. November, öffnet das Frauenmuseum in Bonn für vier Tage seine Kunstmesse. Gesetzt den Fall, das Virus hat sich bis dahin einigermaßen ausgetobt, wird sie bereits die Sechsundzwanzigste ihrer Art sein. Aber das ist noch gar nichts: Das Museum selbst wird sogar vierzig. Marianne Pitzen gründete es 1981 und steht seither an der seiner Spitze. Zwar darf es nicht für sich in Anspruch nehmen, das einzige seiner Art zu sein: Auch in Fürth und Wien gibt es Frauenmuseen, im vorarlbergigen Hittisau, auch in Meran … Aber als das älteste, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen von Männern dominierten Erde, darf das Bonner Institut wohl gelten. Ein ehemaliges Kaufhaus ist sein Domizil, gelegen mitten in der Altstadt der einstigen Bundesmetropole; umso provozierender musste einst der Titel seiner allerersten Ausstellung klingen: „Wo Außenseiterinnen wohnen“. Knapp neunhundert Präsentationen zeigte es bislang, ungefähr dreitausend Künstlerinnen hatte es zu Gast. Ungeheure Zahlen: im Durchschnitt etwa drei Ausstellungen in vier Monaten – das macht den Kuratorinnen und Mitarbeiterinnen, ihrer Chefin und deren interdisziplinären Partnerinnen so leicht niemand nach. Weil sie das Museum nicht allein als Ort der Kunst und der Künste, sondern ebenso als Forschungszentrum und Archiv, als Austragungsort und Ausgangspunkt für politische Debatten ansehen, wagten und wagen sie immer wieder „Ausfälle“ in die Öffentlichkeit. Die teils aufsehenerregenden Aktionen wollen auf die soziale, mediale und wirtschaftliche Ungleichbehandlung der Geschlechter und die Verzerrung der Geschlechterbilder aufmerksam machen und sind überdies ökologischen Zielen verpflichtet; nicht zufällig entstand das Museum zu einer Zeit, da die Umweltbewegung an Fahrt und Durchschlagskraft gewann. Geschichtsbewusst dokumentiert es die vergangenen vier Jahrzehnte der Frauenbewegung – und lotet noch weit tiefer in die Vergangenheit hinein. Alles in allem explizit weiblich fokussiert und naturgemäß feministisch in der Haltung, will das Museum als Zielpublikum durchaus auch die Männer – oder „männlichen Wesen“, wie die Direktorin sie gern nennt – für sich und seine Themen interessieren, tragen die doch nach wie vor die Hauptverantwortung dafür, wie über Frauen gedacht, gesprochen, geschrieben wird und welches Bild sich der Normalbürger von ihnen macht. „Wir wussten ja, wie wir sind“, sagte Marianne Pitzen unlängst dem Deutschlandfunk Kultur, „es war aber nötig, das öffentlich zu machen.“ Dass das noch immer nötig ist, darf mann getrost für eine Schande halten: In der Republik leben etwa 42 Millionen Frauen – und damit eine Million mehr als Männer; gleichwohl behandeln Letztere sie gern wie eine Minderheit. Darum bleiben die vermeintlichen „Außenseiterinnen“, versteht sich, die wichtigste Besuchergruppe der Ausstellungen und Messen. Für deren Anliegen fand Kuratorin Anna Thinius bei einem Interview im vergangenen Dezember eine pfiffige Devise: „Frauen in die Museen bringen – nicht nur als Nacktmodelle!“ ■
Freundin Sophie
Samstag. 8. Mai „Registriere dich, um Fotos und Videos von Freunden anzusehen“, schlägt der Onlinedienst Instagram den Sonderlingen vor, die dort immer noch nicht angemeldet sind. Die Freundin, die den Userinnen und Usern unter @ichbinsophiescholl nähertritt, stellt sich in einem Steckbrief als 21-jährige Studentin der Philosophie und Biologie vor, die „Kunst & echten Kaffee“ mag und sich knapp mit „Harter Geist, weiches Herz“ beschreibt. Daneben zeigt ein Foto eine sehr junge Frau, das schulterlange Haar gescheitelt, eine Margerite überm linken Ohr, im kindlichen Gesicht ein melancholisch zugewandtes Lächeln. So, ungefähr, könnte die Widerstandkämpferin durchaus auftreten, heute, hundert Jahre nach ihrer Geburt am 9. Mai 1921; so, digital über die sozialen Netzwerke, würde sie sich mit ihren Freundinnen und Freunden austauschen, wenn sie jetzt an der Münchner Universität studierte, wie sie es vom Mai 1942 an für zwei Semester tatsächlich tat. Damals allerdings war man, soweit persönlicher Kontakt nicht infrage kam, auf analoge Mitteilungen angewiesen. Sophie Scholl, ihr Bruder Hans und die anderen Widerständler der „Weißen Rose“ wählten Flugblätter dafür. Die sechste und letzte Ausgabe ließen sie am 18. Februar 1943 in den Lichthof des Uni-Hauptgebäudes segeln. Ihr eigenes Todesurteil hatten sie darauf geschrieben – freilich mit den Worten eines erbitterten Appells an die „deutsche Jugend“: Sie möge den „Weltkriegsgefreiten“ Adolf Hitler mitsamt den „Peinigern“ in seinem Dienst „zerschmettern“; hatte doch der unfähige „Führer“ mit seiner „genialen“ Strategie bis dahin schon „dreihundertdreißigtausend deutsche Männer sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt“. Wurden die Scholls, als ein Hausmeister sie bei der Aktion ertappte, wirklich Opfer ihrer Naivität, wie manche ihnen nachsagen? Rechneten sie, notorisch intelligent und desillusioniert, nicht längst damit, irgendwann aufgegriffen, abgeurteilt, exekutiert zu werden, wie es dann auch, am 22. Februar, durch das Fallbeil geschah? Den „harten Geist“ und das „weiche Herz“ der opferbereiten Heldin zu ergründen, unternahmen seit 1982 immer wieder Filmregisseure wie Percy Adlon – in dem poetischen Porträt „Fünf letzte Tage“ – oder, stärker dokumentarisch, Marc Rothemund; dessen Kinodrama „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ von 2005 zeigt das ARD-Fernsehen am Sonntag, leider erst um 23.50 Uhr, im Ersten. Bereits am Samstag, und schon um 19.20 Uhr, gehen auf 3sat Sabine Jainski und Ilona Kalmbach die Wege ab, auf denen Sophie, „das Gesicht des besseren Deutschlands“, und ihr Vermächtnis seit ihrem frühen Ende rezipiert wurden. Zur „Seele des Widerstands“ ernennt sie gar eine szenische Dokumentation von Stefan Brauburger und Cristina Trebbi aus dem Jahr 2013 in der ZDF-Mediathek. Freilich, wie könnte der Sound des studentischen Widerstands gegenwärtiger klingen als in der Einladung des Südwestdeutschen und des Bayerischen Rundfunks: „Stell Dir vor, es ist 1942 auf Instagram“? In „Echtzeit“ durchquert die Protagonistin (Luna Wedler) mit bisher 503 000 Online- „Freunden“ die letzten zehn Monate ihres großen Lebens, das zu kurz währte, um ihr begreiflich zu machen, „warum dauernd Menschen von anderen Menschen in Lebensgefahr gebracht werden“; und dem mit chauvinistischen Parolen nicht beizukommen war: „Sag nicht, es ist fürs Vaterland!“ ■
Allein oder einsam
Dienstag, 4. Mai Kaum ein Pünktchen gibt sie auf der Weltkarte ab, obwohl sie einen großen Namen trägt: Isla Robinson Crusoe. Fast siebenhundert Kilometer vor Chiles Westküste gelegen, schwimmt die Insel auf dem Pazifik als Denkmal für eine Gestalt der Weltliteratur, für den Seemann, über den Daniel Defoes Abenteuerroman von 1719 Unglaubliches erzählt: Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts wird der Titelheld an die Gestade eines menschenleeren Eilandes gespült, wo er es, überlebenswillig und einfallsreich, fertigbringt, 28 Jahre lang auf sich gestellt zu überdauern. Noch weiter westlich, dafür ein klein wenig größer, hält die Isla Alejandro Selkirk den Gewalten stand, benannt nach dem realen Vorbild Crusoes. 1704 war Alexander Selkirk, ein schottischer Freibeuter Ende zwanzig, während einer Kaperfahrt allerdings nicht hier, sondern auf der Robinson-Insel nach Meinungsverschiedenheiten mit seinem Kapitän zurückgelassen worden. Vier Jahre und vier Monate harrte er auf dem Felsen aus, nicht von blühender Daseinskraft beseelt, sondern gepeinigt von Hunger und Ratten, Melancholie und Einsamkeit. Dann endlich las die Mannschaft eines vorüberfahrenden Schiffs den halb vertierten Kollegen auf. Hin und wieder ist wohl jeder gern allein; einsam immerhin, wie Crusoe oder Selkirk, wollen die wenigsten auch nur ein paar Tage sein, geschweige denn Wochen, Monate – ein Jahr. Freilich mussten und müssen in aller Welt, des Corona-Lockdowns wegen, Unzählige mit unterschiedlichen Graden und Dauern des Verlassenseins Bekanntschaft schließen. Mauro Morandi, „Italiens Robinson Crusoe“, gehört nicht zu ihnen. Zwar mutterseelenallein, aber nicht alleingelassen, nicht verlorengegangen oder ausgestoßen, hauste er 32 Jahre lang auf der Mittelmeerinsel Budelli vor Sardiniens Nordküste. Die wenigen Auskünfte über sie im Online-Lexikon Wikipedia („Länge: 2,1 km, Breite 1,5 km“) schließen mit der knappen Mitteilung: „Einwohner: 1“. Demnächst muss es „Einwohner: 0“ heißen. Denn einem schon Jahre alten Räumungsbefehl wird Morandi, wenngleich widerstrebend, endlich Folge leisten. Die Insel, bislang Privateigentum, ging vor fünf Jahren in den Besitz des Staates über, um in einen Nationalpark umgewandelt zu werden. Zur Geschichte der Gesellschaft gehören seit jeher Menschen wie Morandi, die sich von ihr mit Vorsatz abwenden, überfordert von der Welt oder ihrer überdrüssig oder ihr gar feind. Solche Abkehr, zu radikaler Gottsuche und Bußbereitschaft sublimiert, trieb auch jene Männer und Frauen vor allem des frühen Christentums in die selbstgewählte Isolation, die sich als Einsiedler in Höhlen oder Erdhütten niederließen oder als Styliten, auf Säulen stehend, Wind und Wetter erduldeten. Was Mauro Morandi von dieserart heiligen Landratten und erst recht von den Crusoes und Selkirks der Meere unterscheidet, ist die Freiwilligkeit seiner vermeintlichen Einsamkeit, die eben darum – weil er sich ohne Zwang zu ihr entschloss – in Wahrheit ein entschiedenes Alleinsein ist. Indes sucht sich wohl niemand ohne ein spezielles Naturell ein Leben wie das seine aus. Zum Menschenfreund taugt Morandi sicher nicht; vielleicht ists gut, dass er der Mitwelt, die ihm unerträglich war, sich seinerseits nicht zumuten will; mag sein, er ist ein Kauz oder ein noch komischerer Vogel. Aber seine Standfestigkeit kann jedem, dem seine Nächsten gelegentlich zu nahekommen, eine Ahnung davon geben, wie es ist, nichts Nutzloses zu brauchen und sich selbst genug zu sein. ■
Geht in Ordnung
Samstag, 1. Mai Ordnung, sagt das Sprichwort, sei das halbe Leben. Wir dürfen die Wendung für dämlich halten: erstens, weil meist unangenehm penible Spießer sie gegen uns verwenden; zweitens, weil sie schlicht nicht stimmt. Das Leben an sich ist Chaos wie die Schöpfung insgesamt. Mag sie auch unergründlich einer „höheren Ordnung“ folgen, dürfen wir Erdenzwerge uns schon freuen, wenn wir von Tag zu Tag unsere kleine Agenda auf die Reihe kriegen. Künftig, so verspricht man uns, werde uns „Künstliche Intelligenz“ dabei immer hilfreicher zur Hand gehen; in die Entwicklung jener selbstlernenden Maschinen investieren wir Menschen in schlichter Einfalt all unser Wissen und Können, damit sie uns dereinst eben dies abnehmen: unser Wissen und Können. Schon jetzt überlassen wir immer mehr unserer Fähigkeiten programmierten Automaten; das Gros unserer Weltkenntnis haben wir abstrakt in digitale Megaspeicher outgesourct. Früher, als keineswegs alles besser war, wars immerhin anders. Da „wusste“ man, was man schwarz auf weiß besaß, getrost nach Hause trug und dort gegliedert vorhielt: auf Papier, am besten im Aktenordner. Früher, da bestanden die Speicher des Wissens aus riesigen Büchersammlungen und zahllosen Regalkilometern, dicht bestückt mit dem, was die meisten von uns noch als „Leitzordner“ kennen – und was freilich nicht zwingend aus dem Stuttgarter Traditionsunternehmen Leitz-Acco kommen muss, sondern ebenso gut von Böttcher, Herlitz oder einem anderen Hersteller stammen kann. Die Technik der Produkte ähnelt sich weitgehend: Im Innern einer Hülle aus robustem Karton sind zwei Metallbügel eingesetzt, die sich mittels eines Hebels öffnen lassen; so können sie Dokumente aufnehmen, die auf ihrer linken Seite im passenden Abstand gelocht sind. Vor 175 Jahren, am 2. Mai 1846, kam in Großingersheim der Mechaniker Louis Leitz zur Welt, der das (meist) recht schmucklose, dafür umso dienstbarere Modell erfand. Wie wir alle Klebestreifen oder Papiertaschentücher Tesa oder Tempo nennen, gilt auch der Markennamen Leitz längst für das Ding an sich. Sogar das vorgeblich papierlose Büro kann auf Leitzordner nicht ganz verzichten, noch weniger können es Schüler und Studenten, und in fast allen Haushalten finden sich Bank-, Versicherungs- und ähnliche Unterlagen nach wie vor darin abgeheftet. Der unaufgeräumten Buntheit unserer Welt kommt, durch hohes Organisationstalent, der Aktenordner gehörig in die Quere. In dem Begriff steckt das lateinische Wort agere für machen, handeln. Der Akt und die Aktion – die Tat mithin – rührt daher, und natürlich die Akte auch, ursprünglich ein Dokument bezeichnend, worin Geschehenes und Getanes von Bedeutung schriftlich aufgezeichnet wurde. Ergänzend tritt der Ordner hinzu: In ihm sammeln wir die Teile eines verwirrenden Durcheinanders und gruppieren sie, gewissen Kriterien folgend, zu Einheiten, die uns systematisch Übersicht und Klarheit verschaffen. So wächst eine Art äußeres Gedächtnis heran, das uns, weil künstlich, Objektivität nur vorspiegelt; verdankt es sich doch in Wahrheit den subjektiv gewählten Methoden unseres Sortierens. Dies macht sich, wenn wir Akten ablegen, stets dadurch bemerkbar, dass am Ende ein paar Blätter liegen geblieben sind – und es bleiben immer welche liegen! –, die sich nicht vernünftig unterbringen lassen. Wir entsorgen sie im Ordner „Sonstiges“, in dem sich das Chaos, das wir beseitigt wähnen, im Kleinen wiederholt. ■
Mit Rhinozerosöl
Dienstag, 27. April Mit mancherlei Namen tarnte sich der Satiriker und nannte sich auch schon mal „Sarcasticus“: so viel wie bissiger Spötter also; in seinem Fall darf man auch sagen: Giftspritze. Als Skandalautor firmiert Oskar Panizza noch heute und wollte wohl auch 1894 als solcher gelten, als er dem kaiserzeitlichen Bürgerpublikum den Text seines „Liebeskonzils“ zumutete, einer Art Lesedrama, das mit allem brach, was bis dahin als statthaft, ja überhaupt erträglich galt. Sowohl im Himmel spielt die Handlung wie am Hof des Heiligen Vaters, 1495, in dem Jahr, da die Syphilis begann, Europas Menschen heimzusuchen. Der Gott des Spiels ist ein halbdebiler Knacker, Jesus abgewichst, Maria nicht so sehr Jungfrau wie Halbweltluder. Den Teufel beauftragt sie, in göttlichem Auftrag die entsittete Menschheit strafend zu überfallen. So zeugt Satan mit Salome – die einst lüstern auf die Enthauptung des Täufers Johannes drängte – „das Weib“, die personifizierte Lustseuche, die auf Erden sogleich die Runde macht unter dem sich erotisch haltlos austobenden Borgia-Papst Alexander VI. und seinen kurialen Kumpanen. Panizzas „Gemälde ist nur mit Kot, Spinat und ‚Rhinozerosöl‘ gemalt“, lamentierte der Rezensent der Neuen Bayerischen Landeszeitung, folglich seis nicht schade, „wenn solche Bücher konfisziert und verbrannt werden“. Nicht eingeäschert, aber beschlagnahmt wurde das – in Zürich gedruckte – Buch, und der Verfasser ging wegen „Vergehens wider die Religion“ ein Jahr ins Gefängnis, zu Einzelhaft verurteilt. Wer solch ein Sakrileg ersann, so zeterten die Biederen und Braven, der musste ja wohl verrückt sein, am Ende selbst geschlechtskrank. Beides, um es einzuräumen, traf zu: Der gebürtige Unterfranke – 1853 in Bad Kissingen zur Welt gekommen und in Schweinfurt aufgewachsen – starb als syphilitischer Paranoiker heuer vor hundert Jahren, am 28. September 1921, in der Nervenklinik von Bayreuth. Die dortige Studiobühne wagte sich 2006 an die fünfaktige „Himmelstragödie“, die erst lang nach dem Tod ihres Schöpfers auf Bühnen gefunden hatte, 1967 erstmals, im Kleinformat, in Wien, zwei Jahre später aufwendig in Paris. Zurzeit tritt der polarisierende Autor digital ins Licht: Am 1. Juli wird die von Birgit Franz inszenierte Bayreuther Produktion im Internet zu sehen sein, im Rahmen einer für jedermann und jede Frau zugänglichen Online-Ringvorlesung. Unter Federführung der Germanistin Joela Jacobs von der University of Arizona in Tucson beschäftigen sich die hochkarätig besetzten Vorträge, Präsentationen und Diskussionen noch bis zum 22. Juli mit Oskar Panizza, seinem „Genie und Irrsinn“. So sollen sich „neue Blicke auf seine kontroversen ‚Klassiker‘ “ öffnen, allen voran natürlich auf „Das Liebeskonzil“ (das der Bayerische Rundfunk als Hörspiel in seiner Audiothek bereithält); auch „rücken bislang kaum beachtete Texte in den Fokus“. Darüber, wie stark das satirische Gift, die sarkastische Galle des angriffslustigen Lästerers heute noch wirken, zerbrechen sich Kritiker jedes Mal wieder die Köpfe, wenn sich irgendwo Theaterleute des Ketzerstücks bemächtigen. Die öffentliche Ächtung seines Urhebers und dessen dadurch forciertes trauriges Schicksal brachte schon zu seinen Lebzeiten namhafte Zeitgenossen auf seine Seite, darunter Theodor Fontane und Kurt Tucholsky. Panizza selbst berief sich in seiner Verteidigung vor Gericht auf nachvollziehbar klare Prinzipien: Zum einen sei „die Satire eine in der menschlichen Natur begründete Anlage und kann nicht ausgemerzt werden“; zum andern sei „unsere heutige Zeit der Darstellung des Erhabenen im Göttlichen nicht günstig“. Das gilt erst recht für heute. Und es ist noch gelinde gesagt. ■
Wege zum Selbst
Samstag, 24. April Es könnte alles so einfach sein, vor allem das Leben. „Simplify your life“ heißt die Devise nicht erst seit dem etwas simplen oder vielleicht gar nicht so simplen Slogan, der 2001 Werner Tiki Küstenmachers Bestseller Titel und Thema gab. Befolgen lässt er sich, zum Beispiel, so: „Denke an das, was du hast, statt an das, was dir fehlt!“ „Was uns auch widerfährt, es soll uns von Herzen willkommen sein.“ „Willst du dich zurückziehen, so suche nicht die Küsten des Meers oder die Berge. Keine Zuflucht ist so ruhig und so sicher vor Störung wie deine eigene Seele.“ „Wer sich rächen will, sollte gerade nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.“ Schlichte, indes keineswegs plumpe Ratschläge einer schlichten Lebenshilfe; nicht etwa der Mahatma Gandhi und nicht der Dalai Lama, weder Paulo Coelho noch Jesus Christus haben sie geprägt, überhaupt kein berufsmäßiger Denker, Religionsführer oder Messias, sondern ein Politiker, Staatsmann, Kaiser sogar: Dazu wurde Marcus Aurelius alias Mark Aurel vierzigjährig, im besten Mannesalter. Ein Denker aber war er weit früher: Vor 1900 Jahren, am 26. April 121, in der Metropole des Imperium Romanum geboren, bald als hochbegabt gefördert und vor der Zeit hochgebildet, ließ er sich bereits mit zwölf von der Philosophie der Stoa inspirieren. Die war vierhundert Jahre zuvor in Griechenland entstanden und namentlich durch Ciceros Vermittlung in Rom heimisch geworden. Dem Luxus abgeneigt, in Einfachheit sich kleidend, auf dem Boden schlafend, folgte schon der junge Marcus ihren weisen, wenn auch nicht stets bequemen Weisungen. Im Kosmos ordnet eine vernünftige Vorsehung alles zum großen Ganzen, und auch du, Mensch, bist nicht mehr, nicht weniger als ein Teil davon; alles Irdische ist vergänglich, durchschaue darum auch Besitz, Macht, Ruhm als wertlos; nichts hat Bestand außer dem Wandel, darum klammere dich an nichts, sondern wandle auch du dich; erkenne deine Pflicht gegenüber dem Ganzen; liebe die Menschen, diene ihnen, nie nur dir selbst; fürchte nichts, auch nicht den Tod, der den, der es recht überlegt, kaum schrecken kann … So, in kargen Worten, lauten ein paar seiner Kerngedanken. Eleganter und in der Gelehrtensprache der Zeit, auf Griechisch, hat Mark Aurel sie während seiner letzten Jahre – er starb im Jahr 180 im heutigen Wien – in seinen „Selbstbetrachtungen“ niedergeschrieben; im Original lautet ihr Titel wörtlich Ta eis heautón, lateinisch Ad se ipsum: auf Deutsch etwa „Wege zu sich selbst“. 1559 wurde die Aphorismensammlung, aufgeteilt auf zwölf „Bücher“, in Zürich erstmals gedruckt und hat seither viele Staatsmänner, Herrscherinnen und Regenten zum Nach- und Mitdenken angeregt, so Friedrich II., König von Preußen, und den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Mit sanftmütiger Überlegenheit durchzieht der Grundton einer letztlich pessimistischen, dabei nicht weltfeindlichen und schon gar nicht weltfremden Resignation die 590 Sentenzen, die sich nicht mit metaphysischen Spekulationen abgeben, sondern, sozusagen anwendbar, eine praktische Ethik entwerfen. Ertrage und entsage: Dass Mark Aurel, ein Denker der humanitas, der Menschlichkeit, zugleich die brutalsten Christenverfolgungen seit den Zeiten Neros zumindest duldete, hielt die Kirche nicht davon ab, sich in vielen ihrer Lehren den Zeugnissen seines verständigen Scharfsinns anzuschließen. ■
Im Schlaraffenland
Dienstag, 20. April Denken wir mal an das letzte gute Buch, das wir gelesen haben: Können wir uns dann einen kreativeren Impuls vorstellen als die Idee des Geschriebenen an sich? Die Autorin, der Schriftsteller hat, was Schöpferkraft in ihrem oder seinem Hirn und Herzen, in der Fantasie erzeugte, in Zeichen und Zeilen, Worten und Sätzen niedergelegt; und unser Auge liest es lesend auf wie das Baugut einer anderen Welt, die wir uns selbst daraus zusammenfügen. Dabei verwandeln wir das Geschriebene, indem wir es uns anverwandeln, will sagen: durch die Linsen und Spiegel unseres eigenen Innern brechen und uns zu eigen machen. Zwangsläufig wird mithin das Werk in unserem Hirn und Herzen stets ein wenig (wenn nicht ziemlich) anders aussehen als es der Autor ‚meinte‘. Gut so: Wie könnte er allein zu dem ermächtigt sein, was seine Literatur in uns bewirkt? Wir selbst sind es in gleichem Maß. Wer von uns kennt denn eine Dichterin, wer steht schon einem Literaten nah genug, um sich vertraulich über das Geschriebene mit ihr oder ihm auszutauschen. Und sollten wir es überhaupt, hätten wir Gelegenheit dazu? Weiß denn der Urheber eines Textes zwingend am besten Bescheid über ihn? Sofern es bei der Lektüre Regeln gibt, so lautet die oft zitierte erste stets: Frage nicht, was der Verfasser damit sagen will; frage: Was sagt uns sein Text? Die Suche nach der Antwort legt uns Eigenverantwortung auf – und eröffnet uns gerade dadurch eine Lust: Das Buch, das wir in Händen halten, gehört uns wie ein Geschenk, was darin steht, hat uns, wer immer es schrieb, gleichsam zur freien Verfügung überlassen. Ein Schlaraffenland ist die Welt insofern, als sie unausschöpflich voller Bücher ist, und darum versteht es sich von selbst, dass es einen „Welttag des Buches“ gibt, seit 1995 an jedem 23. April und heuer also am kommenden Freitag. Bei den zahllosen Veranstaltungen des „bundesweiten Lesespaßes“ führen die Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Kinder- und Jugendbuchverlag „cbj“ und die Deutsche Post die Feder. Zum 25. Mal können sich Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften sowie aus Förderschul- und Übergangsklassen ein Geschenk abholen, diesmal einen „Comicroman“, vom heutigen Dienstag an bis zum 30. Juni in insgesamt etwa 3500 Buchhandlungen im Lande: Die Geschichte „Biber undercover“ schrieb Rüdiger Bertram eigens für den diesjährigen Welttag. „Wie der Mensch ins Buch gerät“, dass muss und kann jeder von uns, egal in welchem Alter, zumindest bei jedem gediegenen Text neu als Wunder erfahren. Auch Hektor Haarkötter, in seinem pfiffigen Kompendium „Der Bücherwurm“, geht der Frage nach; dem einschlägigen Kapitel stellt er ein Zitat unseres hochfränkischen Nationaldichters Jean Paul voran, der für Bücher eine so glühende Passion hegte wie kaum jemand vor und nach ihm: „Ein rechtes Werk“, schrieb der produktive Wortzauberer, „verschlingt den Verfasser und später den Leser, beide denken nicht mehr an sich.“ Derart weltvergessen zu lesen, mag uns nicht immer, mag auch nicht jedem gegeben sein. Aber wir können uns leicht darin üben. Um den Kirchenvater Augustinus an ein gutes Buch (in seinem Fall die Bibel) zu binden, genügte im fünften Jahrhundert der lateinische Ruf eines spielenden Nachbarskindes, den er zufällig aufschnappte, „Tolle, lege!“ Nicht anders lädt uns heute unsichtbar jeder Autor ein, der sich uns auf dem Bucheinband vorstellt: „Nimm und lies!“ ■
Herr von Vinci
Samstag, 17. April Beim einen, dem Herrn Buonarroti, sind wir gewohnt, ihn – fast unhöflich – beim Vornamen zu nennen: Michelangelo. Den anderen, Leonardo, nennen wir gern „da Vinci“, obwohl das nun wirklich kein Nachname ist. Vor einer Woche wieder: Da berichteten Focus, Handelsblatt und viele andere Medien, der neue Dokumentarfilm eines Franzosen untermaure einmal mehr den Verdacht, dass der „Salvator Mundi“, den das Aktionshaus Christie’s 2017 in New York für umgerechnet 373 Millionen versteigerte, nicht „als ein von dem Großmeister geschaffenes Werk gelten" könne; zwar sei dies teuerste Gemälde aller Zeiten „in einem Atelier da Vincis entstanden, der Meister aber habe selbst lediglich ‚beigetragen‘ “. Überhaupt bestünden „seit Langem Zweifel daran, dass das Gemälde allein oder hauptsächlich von da Vinci geschaffen wurde“. Recherchiert und gedreht hat die Filmdoku Antoine Vitkine, den wir, begegnete er uns, selbstverständlich nicht mit dem duzfüßigen Antoine überrumpeln, sondern angemessen Monsieur Vitkine nennen würden. So auch dürften wir den Künstler Buonarroti als Schöpfer der Fresken in Roms Sixtinischer Kapelle angeben, freilich auf die Gefahr hin, dass nicht alle wüssten, dass wir Michelangelo meinen. Bei Leonardo liegt der Fall komplizierter. Er heißt definitiv nicht „da Vinci“, vielmehr gibt der Zusatz den Ort seiner Herkunft an: Nahe der Kleinstadt Vinci, die dreißig Kilometer westlich von Florenz liegt und heute mit einem kleinen Museum an seinen (einzigen wirklich) ‚großen Sohn‘ erinnert, wurde das Universalgenie 1452 im Dörfchen Anchiano von einer schlichten Magd geboren. Trotzdem tummelte es sich, als vor zwei Jahren sein Todestag zum 500. Mal wiederkehrte, als „da Vinci“ in Zeitungen und Magazinen, in Fernsehen und Internet. Was hindert uns nur daran, den „Großmeister“ richtig beim Namen zu nennen? Beim Philosophen Aristoteles, dem Dramatiker Sophokles und seiner lyrischen Kollegin Sappho tun wirs ja auch; dass sie, wie die alten Griechen überhaupt, keine Nachnamen führten, stört uns nicht. Bei prominenten Heiligen wie Thomas von Kempen oder Theresa von Ávila verfielen wir nie auf die Idee, in den beigegebenen Ortsbezeichnungen etwas anderes zu vermuten als eben dies: die Orte ihrer Geburt. Nicht anders verhielt es sich zunächst mit der Familie van Beethoven: „Vom Rübenacker“ bedeuteten die zwei Wörter, als die Sippe ländlich-sittlich noch in Flandern hauste. Später wurde allerdings ein Name daraus, und heute weiß jedes Kind, dass es nach dem berühmten Komponisten im Lexikon nach B wie „Beethoven, Ludwig van“ suchen muss. Im Fall der tragisch jung verunglückten Schlagersängerin Alexandra wiederum wie auch bei der japanischen Stargeigerin Midori, beim französischen Filmkomiker Fernandel oder dem Schweizer Dirigenten Adriano lassen wir uns von jeher Einzelnamen als Eigennamen gefallen und fragen nicht, ob die Herrschaften so in Wirklichkeit und wie sie womöglich weiter hießen oder heißen. Der große Leonardo aus dem kleinen Dorf müsste sich, wollte er heute einen Pass beantragen, zur Beglaubigung seiner Existenz als „di ser Piero“ bekennen, weil er unehelich als Sohn „des Herrn Piero“, eines Notars, das Licht der Welt erblickte und später von ihm adoptiert wurde. Hätte der US-amerikanische Autor Dan Brown – wenn schon, denn schon – seinen Weltbestseller „The Da Vinci Code“ von 2003 nicht richtiger „The Anchiano Code“ betiteln müssen? Und wenn die meisten unter uns von „da Vinci“ sprechen, warum dann den Messias Jesus nennen? Sagen wir doch „von Nazareth“. ■
Preisverweigerer
Dienstag, 13. April Beinah Tag für Tag erfahren wir, dass irgendwo irgendjemand irgendeinen Preis erhält. Ihrer gibt es unzählige. Die dennoch handverlese Schar der Wenigen, die einen bekommen, muss sich nicht schämen, stolz darauf zu sein. Im Irrtum aber befänden wir uns, nähmen wir an, solche Freude müsse jeden Preisgekrönten erfüllen. Im Gegenteil. Immer wieder treffen bedeutende Ehrungen auf Menschen, denen sie ganz und gar nicht willkommen sind. Dabei müssen wir noch nicht mal an sogenannte Negativpreise denken, die nicht als Lohn gedacht sind, sondern als Maßregelung. So öffnete sich die „Verschlossene Auster“ des Netzwerks Recherche wohl kaum auf dem Schreibtisch eines Facebook-Managers, nachdem sie dem Unternehmen 2016 zuteil geworden war; auch prangte die „Goldene Kartoffel“, von den „Neuen Deutschen Medienmachern“ (und -innen) für besonders lausige Berichterstattung verliehen, 2018 gewiss nicht in der Vitrine der Bild-Zeitung; und als im vergangenen Jahr die Foodwatch-Aktivisten die Firma Hochland – für einen Käse aus Milch von „Freilaufkühen“, die in Wahrheit im Stall standen – mit dem „Goldenen Windbeutel“ heimsuchten, füllte nicht etwa eine steife Brise die Segel des Betriebs, vielmehr blies der öffentliche Wind ordentlich von vorn. Die große Aufmerksamkeit, die begehrte Kulturpreise auf sich ziehen, wird noch übertroffen, wenn jemand sie nicht haben will, wie 1926 Sinclair Lewis den US-amerikanischen Pulitzer-Prize. Zwei Mal verweigerten sich Schriftsteller dem Nobelpreis: 1958 Boris Pasternak („Doktor Schiwago“), den, unübersehbar gegen seinen Willen, die sowjetische Regierung dazu zwang, und 1964 Jean-Paul Sartre, der seiner „Unabhängigkeit“ zuliebe überhaupt keine Auszeichnungen akzeptierte. Wiederum nahm Günter Grass zwar 1999 den Nobelpreis an, hatte aber 1982 den Premio Feltrinelli abgeschmettert, Italiens höchste Ehrung für Wissenschaft und Kultur. Ähnliches trägt sich gelegentlich auch im Bereich von Film, Fernsehen und Entertainment zu. Gerade jetzt vor fünfzig Jahren machte der US-Schauspieler George C. Scott mit einer Drohung ernst. Zwar zog bei der Oscar-Verleihung am 14. April 1971 Goldie Hawn aus einem versiegelten Umschlag seinen Namen als den des besten Hauptdarstellers – Scott hatte als Titelheld des Kriegsfilms „Patton – Rebell in Uniform“ brilliert –, aber er wies die Trophäe zurück: Für bedeutungslos hielt er den Academy Award, die dauernde Konkurrenz der Schauspielerinnen und Schauspieler für unerträglich und die Show selbst für eine „Fleischbeschau“. Niemand durfte behaupten, nicht gewarnt gewesen zu sein: Im Jahr zuvor hatte Scott schon von einer möglichen Nominierung nichts wissen wollen. Mit ähnlich spektakulären Absagen folgten seinem Beispiel später Marlon Brando und Jane Fonda. Hierzulande unvergessen bleibt der TV-Auftritt des verewigten Literaturpapstes Marcel Reich-Ranicki, der 2008 für sein Lebenswerk einen der Deutschen Fernsehpreise erhalten sollte: Er habe, zeterte er live in die laufenden Kameras, „nicht gewusst, was hier auf mich wartet“, und fand es entsprechend „schlimm, dass ich diesen Blödsinn, den wir hier zu sehen bekommen haben, viele Stunden ertragen musste“. Sein Fazit „Ich nehme diesen Prrreis nicht an“ ist inzwischen fast zum Sprichwort geworden. Für manche ist der Preis zu hoch, den sie für einen Preis bezahlen sollen. Da ists vielleicht ganz gut, dass die Wenigsten von uns je einen kriegen werden. ■
Alles tot
Samstag, 10. April So viel Charakter wie seine Handschrift hatte der Schreiber selber nicht. Datiert mit dem 29. Mai 1962 und in ansehnlich flüssigen, blauen Tintenzügen bat Adolf Eichmann, der gnadenlose Chefbürokrat der nationalsozialistischen Juden-Vernichtung, den israelischen Staatspräsidenten Jizchak Ben Zwi um Gnade, ausgerechnet er. Jetzt vor sechzig Jahren, am 11. April 1961, hatte in Jerusalem der Prozess gegen den Vollstrecker der 1942 in der Berliner Wannseekonferenz beschlossenen, massenmörderischen und fabrikmäßig ins Werk gesetzten „Endlösung der Judenfrage“ begonnen; am 15. Dezember erging das Todesurteil; gut ein halbes Jahr später wurde es vollstreckt. Er sei, schrieb Eichmann zwei Tage zuvor im Bittbrief, ein viel zu kleines Licht gewesen, als dass er „die Verfolgung der Juden selbständig hätte betreiben können“; seine Richter hätten die „Tatsache übergangen, dass ich niemals einen solchen Dienstrang hatte, der mit so entscheidenden, selbständigen Befugnissen hätte verbunden sein müssen.“ Stets nur „im Auftrag“ und also ohne eigene Verantwortung habe er gehandelt und sogar „unter dem Eindruck der erlebten unerhörten Gräuel sofort um meine Versetzung gebeten“. Ein letztes Mal fasste Eichmann damit die Argumentationslinie seiner Verteidigung vor Gericht zusammen, ohne Erfolg. So wenig wie sein eigenes Gnadengesuch verfingen einschlägige Bittschriften Vera Eichmanns, seiner Frau, und seiner fünf Brüder: In der Nacht zum 1. Juni 1962 baumelte der Kopf und das Gesicht des Holocausts in Ramla am Strick des Henkers. Der Auslöschung von sechs Millionen Juden ist sein Name aufgeprägt, nicht anders als der Name von Auschwitz als dem grauenvollsten Erinnerungsort des Nazi-Terrors. Als sich von 1963 bis 1965 zwanzig Angehörige der dortigen Lagermannschaft vor einem Schwurgericht in Frankfurt verantworten mussten, klangen ihre Schutzbehauptungen mitunter so, als hätte Adolf Eichmann sie diktiert: Oft sei ihnen der Dienst „verzweifelt“ schwergefallen, aber „wir alle / das möchte ich nochmals betonen / haben nichts als unsere Schuldigkeit getan“. So rechtfertigte sich einer der Schergen, nicht etwa um sich zu entschuldigen – er sprach sich frei von Schuld. Peter Weiss zitiert ihn in seiner 1965 uraufgeführten „Ermittlung“. Der Bühnentext fasst die originalen Prozessmitschriften zusammen, gestrafft und durch einen nüchternen Stil einander angeglichen. Inhaltlich hinzuerfunden hat der Schriftsteller nichts: Das Unbeschreibliche, das die elf musiklosen „Gesänge“ seines „szenischen Oratoriums“ zu beschreiben suchen, trug sich genau so im größten Vernichtungslager der SS zwischen „Rampe“, Folterstuben und Krematorium zu. Die große Mehrheit derer, die zusammengepfercht in Viehwaggons dort ankamen, wurde nackt ins Gas getrieben, wo „nach 32 Minuten endlich alles tot“ war, wie ein Obersturmführer notierte. Die hochmodernen Verbrennungsöfen glühten und rauchten 24 Stunden täglich. Auch sechzig Jahre nach dem Jerusalemer Prozess darf die Erinnerung an Hitler und Himmler, Heydrich, Eichmann oder Höß, an Auschwitz und Majdanek, Treblinka und die anderen Orte der Verdammnis nicht „endlich tot“ sein. In jeder gymnasialen Oberstufe sollte Peter Weiss‘ „Ermittlung“ als Pflichtlektüre durchgenommen werden. Nicht auszudenken, bliebe das Gedenken denen überlassen, die sich auf Befehl und Gehorsam berufen oder gar leugnen, dass es die „Rampe“, das Gas und das Feuer je gab. ■
Schreck, lass nach!
Dienstag, 6. April Manche Geschichten, mögen sie auch schon oft erzählt worden sein, sind es wert, sie immer mal wieder zu erzählen. Diese, eine Skandalgeschichte, gehört dazu. Am Abend des 28. Mai 1913, an dem sich der Skandal ereignete, liefen zweitausend Herrschaften der besten Pariser Gesellschaft herausgeputzt im Théâtre des Champs-Élysées ein; dass sich ein Skandal ereignen sollte, war abzusehen und vielleicht sogar gewollt. Kaum erklangen die ersten Takte der neuen Komposition, begann Gekicher. Als sich der Vorhang hob und die Tänzerinnen und Tänzer der gefeierten, von Vaslav Nijinski choreografierten Ballets Russes die avantgardistische Musik in ungeschauten Bewegungen wiedergaben, da gerieten die feinen Herrschaften außer Rand und Band. Der Multiästhet Jean Cocteau, der mit viel Prominenz der Uraufführung beiwohnte, beschrieb das Geschehen mit häufig zitierten, immer wieder schön zu lesenden Worten: „Der Saal revoltierte von Anfang an. Man lachte, höhnte, pfiff, ahmte Tierstimmen nach“, Rufe und Fäuste erhoben sich, Ohrfeigen klatschten auf rasierte oder gepuderte Backen, Herren forderten einander zum Duell. Die vorgeschichtliche Opferung einer Jungfrau zu aufreizend unliebenswürdigen Dissonanzen und zornig bebender Rhythmik – das war zu starker Tobak für ein mondänes, aber schwer zu inspirierendes Pariser Publikum des ausgehenden fin de siècle: Vom 30-jährigen Neutöner Igor Strawinsky und seinem gerade mal 35-minütigen Tanztheaterstück hatte es sich halb um den Verstand und ganz um seine Selbstkontrolle bringen lassen. Indes bescherte der vermeintliche Reinfall den um keinen kreativen Hakenschlag verlegenen Urheber des Skandalwerks den internationalen Durchbruch: Le Sacre du Printemps (Das Frühlingsopfer) verlor bald seine Schrecken und firmiert seither sowohl als ein Hauptwerk des jungen Meisters als auch als Meilenstein der Musik überhaupt. Drei Jahre vor dem rüden Expressionismus des Sacre hatte Strawinsky mit dem akustischen Lichter- und Farbenrausch seines „Feuervogels“ einen Gipfel des Impressionismus erklommen, nachfolgend mit „Petruschka“ fesselnd eine volkstümlich bunte Jahrmarktstragikomödie entfaltet, 1920 sich mit „Pulcinella“ geradezu behaglich auf barocke Vorbilder zurückbesonnen. Dann aber experimentierte er immer ambitionierter mit einer zunehmend avancierten Atonalität, neusachlichen Gestaltungsmitteln, Impulsen des Jazz, einer Kontrapunktik, die durch die Zwölftonmusik erneuert worden war … Zwar schloss keine seiner abwechslungsreich für sehr unterschiedliche Foren und Ensembles ausgearbeiteten, Schöpfungen an die Erfolge der genannten vier populären Glanzstücke an, nicht einmal die suggestive „Psalmensymphonie“ von 1930 oder die 1951 uraufgeführte Oper „The Rakes Progress“. Gleichwohl ragt Strawinsky, der vor fünfzig Jahren, am 6. April 1971, in New York 88-jährig starb, als eine Art Picasso der Musik aus der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts – und nicht der Tonunst allein – heraus: Geradezu einen Längsschnitt zog er durch das Säkulum, als einer jener raren Einzigartigen, die während ihrer Lebenszeit alle aufkommenden Stile begründen und vollenden halfen. Unablässig erneuerte er sich in seinem Ingenium; kaum fassbar die Vielgestalt und inhaltliche Vielfalt seiner Produktion. Auch wenn seine Musik es dem Hörer oft nicht leicht macht: Das abschreckende Todesurteil seines berühmten Kompositionslehrers Nikolai Rimsky-Korsakow – „Das ist unerträglich!“ – hat seine Mit- und Nachwelt gründlich revidiert. ■
Eier aus Kunst
Samstag, 3. April Im Fernsehen, vor wenigen Tagen im Krimi „Allmen und das Geheimnis der Erotik“, hätten wir Heino Ferch beobachten können, wie er als blasierter Schlaukopf ein unbezahlbares Fabergé-Ei klaut. Im Kino, in „James Bond 007 – Octopussy“, bangten wir 1983 um den britischen Spezialagenten, der in lebensgefährliche Tauschaktionen um eine Preziose gleicher Art geriet. Auf einem Flohmarkt in den USA erwarb ein Schrotthändler 2014 einen gut acht Zentimeter großen Klumpen Altgold für 14 000 Dollar und fiel aus allen Wolken, dass er ein verloren geglaubtes russisches Fabergé-Ei aus Zarenbesitz in Händen hielt, 33 Millionen Dollar wert. Wir müssen die Miniaturprunkstücke, die unter dem Namen des Juweliers Peter Carl Fabergé (1846 bis 1920) firmieren, nicht schön, dürfen sie sogar kitschig finden – ungeachtet aber aller Mäkelei bestätigen sie uns gerade in der Osterzeit auf ihre grazile Art, dass das Ei mit seiner Symbolkraft nach Kunst, zumindest nach Kunsthandwerk dringend verlangt. Satirisch kommt es bei dem faszinierenden niederländischen Maler Hieronymus Bosch vor, der in einem Bild von 1561 ein verschrobenes Sängerensemble aus einem zersplitterten Ei wie aus einem Narrenschiff heraus trällern ließ. 1936 malte René Magritte sich selbst, wie er, die Palette in der Linken, mit der rechten Hand eine Taube auf eine Leinwand pinselt, während er, nach links starrend, ein weißes Ei auf einem Tisch fixiert, als dächte er darüber nach, was wohl „zuerst da“ war. Ein Jahr später fand Salvador Dalí, aus ähnlich surrealistischem Geist, zu einer seiner raffiniertesten Schöpfungen: Auf dem Bild kauert Narziss selbstversunken und -verliebt an einem Teich, allerdings erscheint sein Abbild nicht auf dem Wasserspiegel, sondern am Ufer neben ihm, als Hand, deren Finger anstelle seines Kopfes zart ein Ei (mit Blume) halten. Zwischen 1994 und 2006 bildete Jeff Koons mit dünnem Edelstahl ein „Cracked Egg“ nach, die zweiteilig-gezackte Schale eines aufgebrochenen und ausgelöffelten Eis in fünf Versionen – blau, rot, magenta, violett und gelb –, jeweils stolze 1,65 Meter hoch ... In der Kunst ist Ostern immer; erst recht in einer Gemeinde auf der Schwäbischen Alp mit dem frühlingshaften Namen Sonnenbühl: Dort zeigt ein einschlägiges Museum das ganze Jahr über Ostereier in allen erdenklichen altmodischen oder hippen Bemalungen und Verwandlungen, mal mit Reißverschluss, mal fast ohne Kalkschale, sogar als klingende Spieluhr. Kreative Köpfe aus aller Herren Ländern nahmen sich Eier in allen Größen und Grundfarben vor, um sich kolorierend und beklebend, sägend und fräsend an und in ihnen zu verwirklichen. Jene fragil umhüllten Keimzellen haben, versteht sich, Vögel, Hennen zumeist, gelegt; den Transport der natürlichen Kunstwerke aber besorgt zurzeit der Hase. In ihm sahen unsere vorchristlichen Vorfahren, schon irgendwie österlich, Wiedergeburt und Auferstehung verkörpert; heute bringen wir ihn gern mit Vorsicht, aber auch mit Schlauheit in Verbindung, mit Zeugungskraft und -lust und der fixen Fertigkeit, hakenschlagend zu entwischen. Zufrieden nahmen wir darum vor zehn Tagen die Frohbotschaft des Deutschen Jagdverbands zur Kenntnis, dass Meister Lampes Bestände in Deutschland von 2019 bis 2020 um gut vierzehn Prozent gewachsen seien, was wir, wie es heißt, den trockenen Frühlingen der vergangenen Jahre verdanken. So hat, mit Blick auf Hase und Ei, die heidnischen Symbole des höchsten christlichen Feiertags, sogar der Klimawandel sein Gutes. ■
Ruhe an Ostern?
Dienstag, 30. März Für ein paar Tage haben sie in Berlin so getan „als ob“ – als ob sich der Corona-Krise ein Schnippchen schlagen ließe. Da machten die Philharmoniker Kultur, und zwar so richtig: Am angestammten Ort, in Schwarz und vor lebendigem Publikum gaben sie ein Konzert (Rachmaninows Zweite), und die Zuhörerinnen und Zuhörer tobten begeistert. 520 hatten einen Covid-Test mitgebracht, 480 absolvierten ihn an Ort und Stelle, was binnen anderthalb Stunden erledigt war. Ein „Pilotprojekt“ – und mit was für einem Erfolg! Nicht anders im Berliner Ensemble: Dort quittierte ein getestetes und mit FFP2-Masken ausgerüstetes Auditorium die Produktion „Panikherz“ nach dem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre „mit Szenen- und erleichtertem Schlussapplaus“, wie der rbb vermeldete. Schon freute sich Philharmoniker-Intendantin Andrea Zietzschmann, endlich lasse sich ein „kreativer, konstruktiver und verantwortungsbewusster Umgang finden, trotz der Pandemie wieder Kultur zu veranstalten". Zu früh gefreut: Nun hat das Berliner „Testing“ mit Musik, Bühnenkunst und Club-Events erst einmal ein Ende. Die „Osterruhe“, wie sie Bundeskanzlerin Angela Merkel zunächst ausrief und dann schuldbewusst stornierte, sie bleibt der metropolitanen Kultur verordnet: Der Senat lässt die Schau- und Hörplätze von Gründonnerstag bis Ostermontag schließen und verschiebt den Modellversuch oder streicht ihn ganz. In Tübingen (Sieben-Tage-Inzidenz am 28. März: 98,8) geht es anders zu: Das Landestheater will das Testprojekt weiterlaufen lassen, mindestens bis zum 18. April. Von einer „enthusiastischen Aufbruchstimmung“ bei Ensembles und Publikum berichtete Intendant Thorsten Weckherlin dem Deutschlandfunk Kultur. „Nur wenn die Inzidenz um unser ‚kleines gallisches Dorf‘ herum immer mehr in die Höhe geht, werden auch wir uns fragen müssen: Ist es richtig, was wir hier machen?“ Ist das richtig, was die in Hollywood machen? In der Süddeutschen Zeitung war zu lesen, die Organisatoren der Oscar-Verleihung hätten angeordnet, dass, wer in der Nacht zum 26. April den Filmpreis bekommen wolle, sich schon persönlich nach Los Angeles bemühen müsse, und gefälligst in einwandfreier Kleiderordnung. Entscheidungen wie diese mögen nicht recht zum gegenwärtigen pandemischen Geschehen passen, allerdings könnten jene, die sie treffen, also Frau Merkel und der US-Regisseur Steven Soderbergh, die theologische Bedeutung der Ostertage für sich reklamieren. Denn die haben ja, als Fest der Auferstehung, gerade nicht mit Lockdown, also Abriegelung oder Ausgangssperre, zu tun, sondern vielmehr mit dem Gegenteil, mit dem „Aufbruch“ nämlich und dem „Enthusiasmus“, die Theaterleiter Weckherlin in Tübingen beobachtete. Als Freudenfest lockt Ostern die Menschen nach dem lähmenden Winter und der todesbewussten Passionszeit hinaus in die Vitalität des Frühlings. Darum hatte vom dreizehnten bis ins neunzehnte Jahrhundert das „Osterlachen“ in den Feiertagsgottesdiensten Tradition, ein heutzutage unter Geistlichen wieder auflebender Brauch, die Gemeinden humoristisch aufzuheitern. Ähnliches tat Stuckrad-Barre live im Berliner Ensemble, wo er, augenscheinlich ohne Lust auf Fastenzeit und Osterruhe, quietschvergnügt über die Bühne hampelte: „Endlich wieder unter Menschen!" Zwar behauptet der grämliche Mönch Jorge aus Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“, Jesus habe „nie gelacht“. Aus den Evangelien indes lässt sich das nicht belegen. ■
Wahres Gleichnis
Samstag, 27. März Sehr ‚deutsch‘ war er nicht. Heinrich Mann wuchs heran, während seine Heimat als „zweites Kaiserreich“ und in ihm zahllose gefügige Untertanen großmannssüchtig nach einer maßgeblichen Rolle in der Welt verlangten. Mit gleicher dichterischer Hochbegabung gesegnet wie der zum „Großschriftsteller“ auserwählte Thomas, war Heinrich nicht gesonnen, sich gleich dem (zeitweilig feindlichen) Bruder auf gehobenes „Deutschtum“ einzustellen. Ein großer Romancier, einer der großartigsten deutscher Zunge, wurde gleichwohl auch aus ihm. Doch war die deutsche Zunge für sein Schreiben nur ein Idiom, die (nord-)deutsche Herkunft nur eine Wurzel. Denn früh schweifte sein Denken kosmopolitisch aus und fand namentlich in Frankreich, in dessen leichterer Lebensart und aufnahmebereiter, ertragreicher Kultur, namentlich in der luziden Literatur seiner lebensklugen Autoren eine zweite Heimat, vielleicht die eigentliche. So freilich geriet er in Verdacht, sich mit dem ‚Erzfeind‘ zu verschwören. 150 Jahre nach seiner Geburt – am 27. März 1871 kam er in Lübeck zur Welt – verleiht jene doppelte Blickrichtung seinem Œuvre eine so unterhaltsame wie aufschlussreiche Dialektik. Zugegeben, unter einheimischen Lesern rangieren die deutschen, gleichsam ‚antideutschen‘ Satiren an erster Stelle, und wahrlich finden sich Meisterstücke darunter. Zu Recht gilt nach wie vor der „Professor Unrat“ von 1904 als eines (auch durch Josef von Sternbergs Verfilmung als „Der blaue Engel“ von 1930). In der seinerzeit beachtlichen Reihe deutschsprachiger Schüler- und Lehrerromane wohl das einzige Buch, darin der Fokus auf einem scheiternden Pädagogen liegt: Widerstandslos geht der stocksteif-sittenstrenge Gymnasialpauker Raat in den Armen und Umarmungen einer liebenswert liederlichen Tänzerin unter. Noch überragt wird die tragische Prosakomödie von dem 1914 vollendeten „Untertan“ um den stupid-heimtückischen Kleinstadtkapitalisten Diederich Heßling, der es als selbstsüchtiger Opportunist durch plärrende Kaisertreue zum Honoratioren seines Kaffs bringt. Deutlich weniger, leider, wird hierzulande der frankophile Heinrich Mann wahrgenommen, der seiner geistigen Wahlheimat sinnliche Vitalität und freidenkerische Weltläufigkeit verdankt; dabei dürfen die Arbeiten aus diesem Schaffensbereich (mindestens) gleichen Rang beanspruchen. Gewiss darfs die umfangreiche, dramaturgisch und sprachlich funkelnde Trilogie um die Herzogin von Assy; nach Art dreier „Göttinnen“ durchläuft die ehrgeizige Dame im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts ein gestalten- und gefühlsreiches Dasein: nach Freiheit jagend als Diana, als Minerva der Kunst, als Venus der Liebe hingegeben. Vollends in die französische Geschichte bettete Mann den Doppelroman um „Die Jugend“ und „Die Vollendung des Königs Henri Quatre“ ein, sein bis 1938 im französischen Exil entstandenes Hauptwerk. 1700 Seiten umfasst dies „wahre Gleichnis“ von der oft gefährdeten Karriere, der menschenfreundlichen und friedliebenden Regentschaft und dem nur scheinbar sinnlosen Tod des 1610 ermordeten „guten Königs“ Heinrich von Navarra. In dem weltgeschichtlichen Umbruch, durch den der deutsche Faschismus jeden Begriff von Macht größenwahnsinnig desavouierte, unternahm es Heinrich Mann, die Idee historischer Größe zu retten, indem er ein französisches Idealbild von humaner Führerschaft ersann. ■
Alte Wunder
Dienstag, 23. März Gern hängen wir dem Irrtum an, unsere Vorfahren seien bei weitem nicht so clever gewesen, wie wir heute sind. Dabei sollten wir uns klar darüber sein, dass auf so gut wie jeden klugen Gedanken, den wir fassen, bereits lang vor uns Menschen verfallen sind. Denn mit den Manifestationen des Erfindergens, das unseren Erbanlagen unauslöschlich eingeschrieben ist, füllen wir unsere Lebensräume, seit wir den Erdball bevölkern. Schon Faustkeil, Boot, Pflug oder Rad haben, gemessen an den äußeren Möglichkeiten ihrer ersten ur- und vorgeschichtlichen Urheber, als sensationelle Pioniertaten zu gelten. Erst recht müssen wir den hellen Köpfen von vor zwei oder zweieinhalb Jahrtausenden zugestehen, dass ihr Ingenium dem unseren das Wasser reichen konnte. Zu den begeisterndsten Belegen hierfür zählt der „Mechanismus von Antikýthera“, den ein Schwammtaucher 1900 südlich der Peloponnes aus dem Mittelmeer barg. Er fand den mit Sediment verbackenen Messingklumpen auf einem etwa 60 vor Christus gesunkenen Römerschiff; doch stammen die Fragmente aus Griechenland und sind etwa 150 Jahre älter. Dass es sich um eine Wundermaschine handle, stand früh fest; später offenbarten Röntgenaufnahmen, noch später Computertomogramme fein gearbeitete Einzelheiten der gezackten Scheiben und darauf gravierte Lineaturen und Ziffern. Am Wochenende berichteten Medien, Forscher des Londoner University College hätten nach der Rekonstruktion der fehlenden Komponenten das Geheimnis der etwa vierzig Zentimeter großen Apparatur nun entschlüsselt: Das Zahnräder- und Rechengetriebe – handwerklich so detailliert ausgeführt, wie unsere geschicktesten Vorfahren dies erst mit Beginn der Neuzeit wieder vermochten – integriert ganz offensichtlich die komplette Himmelsmathematik der Babylonier, Griechen und Römer und ermöglicht es, sie praktisch anzuwenden, um den Lauf von Sonne und Mond sowie der in der Antike bekannten fünf Planeten – Merkur und Venus, Mars, Jupiter und Saturn – nachzuvollziehen und vorherzusagen. Selbst heutige Experten halten ungläubig vor dem antiken Geniestreich inne. Und davon gibt es mehrere. Im dritten vorchristlichen Jahrhundert ging der Grieche Ktesibios so virtuos mit Druck und Fluss von Luft und Wasser um, dass es ihm gelang, eine hydraulische Jahresuhr zu konstruieren, die ohne Eingriffe von außen ihren genauen Gleichlauf beibehielt. Oder, im alten Rom, Vitruv: Findig ließ sich der Ingenieur und Architekt im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende ein Odometer einfallen, sozusagen einen Meilenzähler, der exakt angab, welche Strecke ein Wagen zurückgelegt hatte. Zur Legende wurde, in den Jahrzehnten nach Christi Geburt, Heron von Alexandria, aus dessen teilweise überlieferten Schriften sich ermitteln lässt, wie profund er über eine Antriebstechnik mittels Dampfdruck nachdachte, auch über einen Maschinen-Bogen, der automatisch Pfeile abschoss, um sich sogleich von selbst wieder zu spannen, oder über selbsttätige Tempeltüröffner. Zugegeben, Herz-Lungen-Maschinen standen den Babyloniern noch lang nicht zu Gebote, den Griechen fehlte die Telegrafie, den Römern der elektrische Dosenöffner. Auch Wunder brauchen ihre Zeit. Aber wir Menschen, ob genial, ob normal, dürfen uns damit schmeicheln, dass unser Gehirn ein Wunderwerk ist und immer eins war. ■
Anfang mit Ich
Samstag, 20. März „Liebe XY. Wollte Dir noch sagen, wie …“. „ … Muss Dir leider für Donnerstag einen Korb geben.“ „ … Habe soeben erfahren, dass …“ Wo ist es nur geblieben, das Ich in Whatsapp-, E-Mail-, SMS-Nachrichten? Immerhin galt das kuriose Ding, trotz seiner Kürze, mal als so bedeutend, dass sich seit vielen Jahrhunderten Denker des Geistes und Wissenschaftler der Seele, und nun auch Erforscher des Gehirns, haarspalterisch genau damit beschäftigen. Wenn alle Stricke irdischer Gewissheit rissen, so beruhigte sich René Descartes 1637 in seinem „Discours de la méthode“, so bleibe als tiefste Wahrheit doch immer unbestreitbar: „Ich denke, als bin ich“. Was für eine aufklärerische Erleuchtung des um Subjektivität und Individualität ringenden Menschen. Was also könnte wichtiger sein als das Ich? „Ich zuerst“, lautet, scheinbar folgerichtig, die Parole des Egoisten und Hedonisten, der, um an seine Ziele zu gelangen, alles Hemmende zur Seite drängt. So freilich hat Descartes es nicht gemeint, denn er und seinesgleichen waren und sind sich durchaus klar darüber, dass ein Ich sich erst in seinen Verhältnissen zu den anderen erkennt. Scheinbar folgerichtig (zum zweiten Mal) traten schließlich Gelehrte auf den Plan, die die Existenz eines Ichs überhaupt bestritten, um es zu einer bloßen Funktion der umgebenden Gesellschaft zu degradieren. Endgültig das Grab schaufeln wollen ihm manche Vorreiter der Neurobiologie, indem sie zu belegen suchen, dass das, was wir für unser Ich halten, die neuronalen Netzwerke unseres Kopfs uns nur vortäuschten und potente Computer wohl irgendwann vollgültig simulieren könnten. Jener Entwicklung, die sich niemand, der bei Verstand ist, wünschen kann, arbeiten die sozialen Netzwerke zu, sobald ihre Nutzer mit flinken Daumen Botschaften wie diese in die Displays fingern: „Kann dich heute nicht sehen. Muss arbeiten. Werde dich morgen anrufen.“ Manche reden sich damit heraus, solcher Telegrammstil diene dazu, Zeit zu sparen. Wers glaubt! Durch besagte Netze flutet sekündlich so viel überflüssiges Getwitter und Geschwätz, dass hier und da ein „Ich“ das Tipp-Tempo nicht nennenswert verringerte. Wurde es also von Resten einer unbeholfenen, bis zum Duckmäusertum missverstandenen Höflichkeit verschlungen? Wohl kaum. Selbstbeherrschung, Mäßigung und Takt haben, zum einen, in der Cyber-Kommunikation einen schweren Stand. Zum andern empfehlen Brief- und Bewerbungsratgeber zwar, Anschreiben und ähnliche formelle Botschaften nicht mit „Ich“ zu beginnen; seine Eliminierung aber verlangen sie keineswegs, sondern schlagen nur vor, das Wörtchen syntaktisch im Inneren des Satzes zu platzieren. Es scheint also schlicht entbehrlich geworden, das Wort – und damit, wiederum folgerichtig, die Sache selbst. Aber „Ich“ ist wichtig, und man muss kein Egomane sein, um danach zu handeln. Wer leichtfertigt der Bekundung seiner selbst entsagt – verdient der überhaupt, wahrgenommen zu werden? Aller Dekonstruktionsversuche trotzend, sollten wir hin und wieder daran denken, dass uns nur das Eingeständnis unserer Existenz vor Übergriffen und Bevormundungen schützt: Es gibt mich, darum darf ich mir in Whatsapp-Posts, E-Mails, SMS drei zusätzliche Buchstaben wert sein. Wie unabsehbar und unbeeinflussbar unsere Bedingtheiten, wie verzweigt unsere Beziehungsgeflechte auch sein mögen: Individualität hat mit unserem Anspruch auf Freiheit zu tun und mit unserem Versuch, sie zu verteidigen. ■
Inzidenz: null
Dienstag, 16. März Seit uns Peter Wohlleben, der Feel-good-Förster der Nation, das „Geheime Leben der Bäume“ offenbart, muss selbst ein bayerischer Ministerpräsident sich nicht genieren, wenn er einen Baum umarmt. Pflanzen sind die neuen Tiere, das Grün im Topf ist das neue Haustier, wir sprechen ihm gut zu, ersparen ihm Aufregung, kümmern uns um seine Wehwehchen … Und wollen wir der Yuccapalme, dem Gummibaum was ganz besonders Gutes tun, gönnen wir ihnen demnächst vielleicht einen Konzertbesuch. Dafür ging am 22. Juni 2020 Barcelonas größtes Opernhaus mit gutem, dieser Tage hierzulande aufgegriffenem Beispiel voran. Als das Gran Teatre del Liceu nach dem ersten Corona-Lockdown wieder seine Tore öffnete, besetzten 2292 Pflanzen alle Sitze im Parkett und auf den Rängen, um floraler Tonkunst zu lauschen: Vom Konzeptkünstler Eugenio Ampudio eingeladen, intonierte ein Streichquartett die „Crisantemi“, Giacomo Puccinis gefühlvollstes Blumenstück. Jetzt, in Oldenburg, war das Auditorium kleiner, doch nicht weniger ergriffen: Denn Pflanzen, ließ der Trommler Felipe Dias zuvor wissen, „reagieren auf Schwingungen genauso wie ein Menschenpublikum“. Also beschallten er und über zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker im „Theater-Laboratorium“ der Stadt 182 eingetopfte und gewässerte Gewächse zwei Stunden lang. Lobenswert entfalten die Tonkünstlerinnen und -künstler ihr Engagement in einer Zeit, da vor den Rampen der kulturellen Schau- und Hörplätze coronahalber seit Monaten die Leere gähnt und sich nun auch noch die Podien und Bühnen zu leeren scheinen. Vor vier Tagen kündigte der Kabarettist Volker Pispers bedauerlicherweise an, sich aus dem öffentlichen Satirebetrieb zurückzuziehen. Der kanadische Popstar Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd polterte empört, er werde, weil heuer für keinen einzigen Preis nominiert, nie wieder an einer Grammy-Show teilnehmen. Dem Kandidatenschinder Dieter Bohlen – berüchtigt als Juror von „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ und überhaupt eine der schlimmsten Zumutungen des deutschen Privatfernsehens – setzte der Sender RTL unlängst den Stuhl vor die Tür. Am Samstag erging es der ZDF-Schnulzen-Präsentatorin Carmen Nebel, wie es irgendwann jedem Nebel ergeht: Sie verzog sich ... Und so weiter und so fort. Da loben wir uns den Rock- und Popmusiker Sasha: Der empfing am vergangenen Donnerstag in der riesigen, gespenstisch leeren und dunklen Hamburger Barclaycard-Arena Heike Hacker aus Aue und niemanden sonst, um ihr und nur ihr beim Schein von Kerzen und eines Lagerfeuers was vorzusingen. Mit diesem Bild im Kopf leuchten uns die Vorzüge eines ausschließlich vor Vegetation veranstalteten Konzerts erst richtig ein: Niemand kommt zu spät, keiner geht vor Schluss, nirgends Gehüstel, Geschwätz, Geraschel; überall tiefe Konzentration. „Die Musik“, verkündete Eugenio Ampudio in Barcelona, „ist die einzige Sprache, die Pflanzen verstehen oder die sie zumindest beeinflusst.“ Auf Applaus, das schönste Geräusch im Künstlerohr, müssen die Ausführenden zwar verzichten. Dafür läutert das Chlorophyll in den Blättern die Atmosphäre und lädt sie belebend mit Sauerstoff auf. Mag sein, dass unzureichend gepflegtes Grünzeug ein paar Blattläuse einschleppt. Dafür tendiert bei einem rein fleischlosen Publikum die Zahl der Corona-Neuinfektionen gegen null. ■
Schrift im Bild
Samstag, 13. März Kritiker schreiben viel seltener Verrisse, als die Leute meinen. Wenn sies tun, können sie, meist aus verletzter Liebe zur Kunst, allerdings gnadenlos sein. Wie wohl war Edvard Munch, dem großen Maler Norwegens, zumute, als er auf seinem berühmtesten Bild, dem „Schrei“, diese vernichtende Kritik entzifferte: „Kan kun være malet af en gal Mand!“, Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein? War er gekränkt ob der Ablehnung seines Gemäldes, in dem er doch nach dem stärksten Ausdruck größter Angst gesucht hatte? War er stinksauer, weil irgendein Vandale sich angemaßt hatte, sein erschütterndes Werk zu verschandeln? Nichts von alledem: Jüngste Untersuchungen mittels einer Infrarotkamera ergaben, dass die Bleistiftkrakelei, links oben in der 1893 gemalten ersten von vier Fassungen des Sujets, nicht von einem fremden Ignoranten stammt, sondern vom Maler selbst. Schriftvergleiche belegten dies ohne allen Zweifel, teilte das Nationalmuseum in Oslo mit. Pikiert hatte er nach der ersten Präsentation seines Meisterwerks in der Hauptstadt Polemiken zur Kenntnis genommen, der „Schrei“ offenbare, dass er nicht recht bei Verstand sei. Jetzt jubelte die Presse, akribische Forschung habe neuerlich ein Rätsel der Kunstgeschichte geknackt. Aber wars denn eins? Welche Museumsbesucherin, welcher Besucher ohne engen Kontakt zur Wissenschaft bemerkte je die winzige Inschrift? Nein, zum veritablen Geheimnis reicht die Kritzelei nicht; schon gar nicht zur Rarität. Denn Schrift auf Bildern hat Tradition. Etliche Malereien haben einen Titel, bei manchen steht er (sofern er von der Künstlerin, dem Künstler selber stammt) sogar vorne drauf; bei einer weit größeren Zahl verzeichnet ihn die Rückseite der Leinwand. Signierte Arbeiten tragen meist den Namenszug (wie bei Picasso) oder doch das Monogramm des Urhebers (so bei Dürer). Wie Schrift selbst zum Inhalt bildnerischen Gestaltens wird, erhob der 1995 gestorbene Zeichner Horst Janssen in unverwechselbarer Eigenart zu einem Thema seines Schaffens. Weil er auch ein obsessiver Leser (von „Walt Disneys lustigen Taschenbüchern“ bis zu Martin Heidegger) und obendrein Schriftsteller war, versah er viele Blätter handschriftlich mit Wörtern, Sätzen oder ganzen Sermonen, die mit den Linien, Formen, Färbungen auf dem Papier eine grafische Ehe eingehen. Vielleicht war eine von Janssens Quellen das in der Renaissance beliebte Emblem, eine Art Rätselbild, dessen Bedeutung sich erst ganz erschließt, wenn der betrachtende Verstand die drei Komponenten – Überschrift, symbolhaltige Illustration und lyrisches Epigramm – zusammenführt und miteinander verschmilzt. Dass die vor gut fünftausend Jahren erfundene Schrift überhaupt in Bildern wurzelt, erweist jede altägyptische Hieroglyphe. Den Weg ad fontes, zurück zu den Quellen, ging die Konkrete Poesie (etwa eines Eugen Gomringer) ab den 1950ern: Dabei wandelt sich der Dichter zum Bildner, verweigert der Sprache ihre berichtende oder auf etwas verweisende Absicht, abstrahiert also Ausdruck und Bedeutung von den Wörtern und Sätzen und ordnet sie gemäß nur mehr visueller Kriterien an. So findet auch das Wort Grafik zu seinem Ursprung zurück: Das altgriechische gráphein heißt sowohl schreiben als auch zeichnen. Zwischen dem Inhalt des Textes und seiner Optik schwindet die Differenz, der Betrachter ist Leser. Oder umgekehrt. ■
Maria tanzt Tango
Dienstag, 9. März Der Mann war ein Star, nur nicht so recht in seiner Heimat. In Südamerika, zumal in Argentinien, wo Astor Piazzolla vor jetzt hundert Jahren, am 11. März 1921, im großen Seebad Mar el Plata zur Welt gekommen war, verdächtigte man ihn, bloß noch „viel Lärm, wenig Tango“ mehr zu veranstalten: Er wolle wohl, argwöhnten puristische Mahner, als neutönender oder zeitgeistiger Umstürzler den guten alten, kneipenrauchigen Tanz abschaffen, bei dem sich brünstig schwitzende Leiber noch ordentlich aneinander reiben durften. Dergleichen aber hatte Piazzolla nicht vor, die erotische Gier oder seufzende Sentimentalität jener Musik verlor er nie aus dem Sinn: „Der Tango“, dazu bekannte er sich, „ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens“ und sollte das auch als „Tango nuevo“ bleiben, als von ihm erneuerte, ins Artifizielle transponierte Ausdrucksart. Zum „Tangokönig“ krönte den Meister des Bandoneons seine globale Verehrergemeinde, was er sich gern gefallen ließ. Ein Leisetreter durfte ein Bahnbrecher wie er auch gar nicht sein, da passte ganz gut, dass er von Natur aus frei von falscher Schüchtern- und Bescheidenheit war. Gleichwohl entging ihm nicht, dass seiner herausgehobenen Position in der Musikwelt des vergangenen Jahrhunderts etwas Widersprüchliches anhaftete: Er schätzte es, „berühmt“ zu sein, aber klar war ihm auch: „Populär bin ich nicht.“ Zur Lichtgestalt taugte er dennoch, bestrahlte er doch auf sofort erkennbare (und, allerdings, auch oft sich wiederholende) Weise die sogenannte U- wie die E-Musik. Nie verleugnete seine Kunst ihre Wurzeln in der Folklore Argentiniens, in den Puffs und Kneipen der Hauptstadt Buenos Aires; aber sie überwand die Grenzen der Vorstädte und Düsterviertel, indem sie sich ins Internationale und Mondäne wendete. Einflüsse des Jazz, der Rock- und Popmusik sog sie, ohne das Risiko ernstlichen Traditionsverlustes, in sich auf und legitimierte sich formal sogar teils durch Rückgriffe auf den altehrwürdigen Kontrapunkt. Populär wurde Piazziolla damit dann doch: zumindest bei den Propheten und Apologeten einer fortschrittlichen Kunst in Paris oder Wien, überhaupt im damaligen Westen der Welt, nicht zuletzt in New York. Dort, in Little Italy, war Piazzolla seit seinem vierten Lebensjahr aufgewachsen, in zwielichtigen Verhältnissen: „Ich hätte“, erinnerte er sich, „ebenso gut Gangsterboss werden können.“ In Frankreich ging er kurz bei der namhaften Klavier- und Kompositionspädagogin Nadia Boulanger in die Lehre und versetzte sich überhaupt zunftgerecht in die Lage, den verbrauchten „alten“ Tango nicht etwa zu liquidieren, sondern experimentierend aufzufrischen und ihn gleichsam stubenrein aus den Freuden- in die Konzerthäuser und Theater zu geleiten. Meist zwar musizierte er mit kleineren Ensembles, doch griff er auch auf orchestrale und musikdramatische Formate aus: Im Konzert für Bandoneon strebt seine Musik nach symphonischem Volumen; im Gefolge von Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ schuf er, in unterschiedlichen Versionen, eigene „Cuatro Estaciones“, und sogar eine Oper, um das Unglücksmädchen „Maria de Buenos Aires“, gibt es von ihm. Sein ergreifendster Tango heißt „Oblivion“; vor dem titelgebenden „Vergessen“ hat Piazzolla (der 1992 starb) den Lieblingstanz seiner Heimat freilich zu bewahren vermocht. ■
Die Haare der Poeten
Samstag, 6. März In seinem neuen Buch „Der Mann im roten Rock“, das seit wenigen Wochen auch auf Deutsch vorliegt, erzählt der englische Schriftsteller Julian Barnes von so mancherlei, auch von seinem Kollegen Oscar Wilde. Unter anderem gibt er eine Anekdote wider, die im Paris des Jahres 1898 spielt, kurz nach Wildes Entlassung aus dem Gefängnis zu Reading, wo der Poet, einst gefeiert, dann tief gefallen, als Homosexueller zwei furchtbare Jahre hatte absitzen müssen. Mit dem Gedanken an Freitod spielend, sei er zur Seine gegangen und auf dem Pont Neuf auf einen Mann gestoßen, der weltvergessen hinab ins Wasser starrte. Wilde, in der Meinung, einen Leidensgenossen vor sich zu haben, fragte ihn: „Sind Sie auch ein Selbstmordkandidat?“ Doch der Mann entgegnete: „Nein, Friseur.“ Nach dieser „absurden Antwort“, schließt Barnes, „fand Wilde, das Leben sei immer noch so komisch, dass es zu ertragen wäre.“ Ist es ja auch. Es sei, witzelte der geschasste irische Poet, „viel zu wichtig, um es ernst zu nehmen“. Für Friseure wie den Fremden auf der Brücke wurde das Leben freilich mit den Corona-Lockdowns ernst und immer ernster. Seit Montag endlich besteht hierzulande kein Grund mehr für sie, sich das Leben zu nehmen, jetzt, wo die Salons wieder geöffnet haben und die Scheren schnippeln und klappern, bis die Klingen glühen. An Wildes Wolle verdienten die Figaros des Fin de Siècle mal mehr, mal weniger: Den Porträtfotos zufolge, trug er sein Haar auch schon mal kurz, ebenso gern aber in langen, gewellten Schwüngen. Wenig ist über die (jedenfalls dunkle) Farbe bekannt, gleichwohl darf bezweifelt werden, dass sie immer echt war; fand doch der poetische Dandy die Jugend seiner Epoche „grässlich“, weil sie „nicht den geringsten Respekt vor gefärbten Haaren“ habe. Gar keine Ehrfurcht vor Haaren, kolorierten oder naturfarbenen, hegt der französische Erfolgsautor Michel Houellebecq: Seiner Aura des Ungeduschten adäquat, nimmt er professionelle Leistungen zur Veredelungen seiner Frisur nicht in Anspruch, sondern schneidet sich die Haare bei Bedarf selber, „mit der Küchenschere“. So zumindest bekannte er sich vor Jahren in einem Zeitungsinterview der Welt, die sich umso überraschter zeigte, als der notorische Provokateur 2016 bei einer Preisverleihung in Frankfurt die Bühne „im eleganten grauen Anzug, die Haare kurz geschnitten und sauber gescheitelt“, betrat. In seinem Essayband „Ein bisschen schlechter“ von 2019 nannte er Donald Trump, über dessen „opulent-üppige Keratin-Pracht“ mit ihrer „golden-eidottergelben Tolle“ (Stuttgarter Nachrichten) die halbe Welt spottete, zwar einen „haarsträubenden Clown“, aber doch einen „guten Präsidenten“. Ob gut, ob böse: Wie vor Gott (Houellebecq: „Er will mich nicht“) sind vor dem „Friseur alle gleich“, musste auch der scherenklingenscharfe Wiener Gesellschaftskritiker Karl Kraus zugeben. Er übrigens trug das Haar sehr kurz, hätte sich aber, nur weil die Salons geschlossener haben, wohl ebenso wenig umgebracht, wie Oscar Wilde es tat. Für den war „Selbstmord das größte Kompliment, das man der Gesellschaft machen kann“, und die hat, konfus zusammengewürfelt, wie sie nun mal zu sein pflegt, uneingeschränkte Lobreden noch nie verdient. Dass die Deutschen seit Montag ihren gefärbten wie naturbelassenen Haaren wieder „Respekt“ zollen können, hätte dem Iren aber wohl doch ein „Kompliment“ abgerungen: Immerhin wählte er seine „Freunde nach ihrem guten Aussehen“ aus. ■
Nur mit Waffen
Dienstag, 2. März Evolution oder Revolution? Sozialismus oder Sozialdemokratie? Der Letzteren gehört Wolfgang Thierse an, langjähriger Präsident und später Vizepräsident des Deutschen Bundestages. „Die radikalisierten Elemente in der Arbeiterschaft waren nur mit Waffengewalt zu besiegen“, äußerte er vor zwei Jahren. „Das bleibt schmerzlich, auch im Rückblick, aber der Weg, der dann eingeschlagen wurde, war der bessere.“ Der „Rückblick“ reichte, als Thierse dies sagte, hundert Jahre zurück: Damals, am 5. Januar 1919, brach in Berlin der Spartakusaufstand los – und wenig später zusammen. „Gebraucht die Waffen gegen eure Todfeinde“, hatten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Anführer der neu gegründeten Kommunistischen Partei, ihren Gefolgsleuten zugerufen. Als „Todfeinde“ erwiesen sich keineswegs nur Nationalisten, Militärs und radikalkonservative Rechte; auch Spitzenvertreter der SPD reihten sich ein. Zum Beispiel Gustav Noske, gewesener Redakteur, Reichstagsabgeordneter, Militärexperte, Gouverneur von Kiel. Als solcher hatte er im November 1918 geholfen, die Meuterei der Kriegsmarine und die im Umfeld aufflammenden Unruhen auszulöschen. Nun, zwei Monate später, war er erst recht bereit, den „Bluthund“ zu machen: Mit der Schmutzarbeit bei der Niederschlagung des Spartakusaufstands betraute er Waldemar Papst, einen Generalstabsoffizier, von dem bekannt war, dass er gern brutal hinlangte. Kompromisslos rangen Truppen der Regierung und Freikorps die Erhebung nieder; dann befahl Papst, die Anführer zu liquidieren. Zehn Tage nach Ausbruch der Rebellion wurden Luxemburg und Liebknecht festgesetzt, hart geprügelt und erschossen. Noch 1962, im rechtsradikalen Studenten-Anzeiger, brüstete sich Papst damit, als Ankläger, Richter und Retter der Zivilisation fungiert zu haben, in Personalunion: „Ich habe sie richten lassen. Ihr Sieg hätte das christliche Abendland zum Einsturz gebracht.“ Rosa Luxemburgs Geburtstag jährt sich am Freitag zum 150. Mal. Nur 48 Jahre wurde sie alt und hat doch Außerordentliches bewirkt. Als „höhere Tochter“ in Südostpolen geboren, widmete sie sich von Jugend auf der Politik und dem Kampf für eine bessere Welt der Rechtsgleichheit und der „Freiheit der Andersdenkenden“. Schon als auffallend kritisch-hellköpfige Schülerin machte sie die Ziele der Arbeiterbewegung zu ihren eigenen. Um nicht verhaftet zu werden, verließ sie neunzehnjährig die Heimat, um in Zürich Volkswirtschaft zu studieren, ihren Doktor zu machen und sich in den Marxismus zu vertiefen. Zwischendurch half sie 1893, eine sozialdemokratische Partei in Polen zu gründen. Für die deutsche SPD setzte sie sich ein, sobald sie 1898 die Staatbürgerschaft erworben hatte, wobei sie den linken Flügel zu stärken suchte. Sie schenkte sich nichts und nahm alles in Kauf: Den Ersten Weltkrieg verbrachte sie – Mitbegründerin und, an Karl Liebknechts Seite, Hauptaktivistin der antimilitaristischen „Gruppe Internationale“ – fast durchgehend hinter Gittern, bis Novemberrevolutionäre sie 1918 befreiten. Nach Gründung der sich rasch radikalisierenden Kommunistischen Partei sprach sie sich vergebens dafür aus, sich an den bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung zu beteiligen. Also doch Evolution statt Revolution? Im Blutbad der „Bluthunde“ wurden Unterschiede nicht gemacht. ■
Der Mars, tönend
Samstag, 27. Februar Synästhesie ist nicht zwar ein schwieriges Wort, aber eine feine Sache. Der Begriff benennt die Wahrnehmung, die uns widerfährt, wenn wir einen Sinnesreiz aufnehmen, ein Reizwort aufschnappen und unwillkürlich entlegene Eindrücke anderer Sinne sich sogleich mit einstellen. Zum Beispiel berichtete eine liebe Freundin dem Schreiber dieser Zeilen, für sie seien bestimmte Zahlen fest mit bestimmten Farben verbunden. Oder das Aroma eines in Tee gestippten Sandtörtchens: Das überströmte Marcel Prousts Gedächtnis schlagartig mit den vergessen geglaubten Lichtern und Couleurs, Geräuschen und Gerüchen seiner Kindheit auf dem Lande. In den alten Griechen indes finden wir alle unsere Meister: Als musisches Kulturvolk stellten sie ihre gesamte Kosmologie unter ein synästhetisches Konzept. Sie malten sich aus, im Mittelpunkt des Universums ruhe die Erde, um die alle Körper des Himmels gleichmäßig kreisten, und zwar befestigt auf acht hohlen, konzentrischen, durchsichtigen Kugeln; indem jede dieser „Sphären“ sich bewege, erzeuge sie einen ihr eigenen Klang, und weil alle acht ineinander unterschiedlich rotierten, ergebe sich eine harmonische „Sphärenmusik“. Nun aber sind Geräusch, Klang, Tonkunst an die Luft gebunden, die den Schall transportiert, und kommen also im luftleeren Weltraum nicht vor. Umso größer das Interesse an Lauten, die dennoch aus dem Kosmos zu uns dringen. Anders als die antiken Hellenen wissen wir, dass die fünf Planeten, die wir mit bloßem Auge erkennen, dass also Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn nicht auf ein und derselben Kugel, mithin nicht in derselben Entfernung unseren Erdball umlaufen. Darum bläht sich stolz die Astronomen-Brust, wenn es gelingt, eine Sonde auf der Venus landen zu lassen; oder gar auf dem – noch weiter entfernten – Mars. Dieser Tage hat der US-Rover „Perseverance“ ihn erreicht. Bis dahin war er fünfhundert Millionen Kilometer weit und ein gutes halbes Jahr lang unterwegs. Das Warten lohnte sich, auch akustisch: Der Mars gibt Laut, erstmals für uns hörbar. Denn das Mikrofon des Fahrzeugs fing Töne ein: Der höhere von ihnen verdankte sich zwar der bordeigenen Maschinerie; einen dumpferen aber erzeugte der planeteneigene Wind, der mit 180 Stundenkilometern den Landeplatz, einen Krater namens Jerezo, durchbrauste. Recht dünn ist die Gashülle rund um den Mars. Wir Erdlinge genießen das Glück vergleichsweise dicker Luft, die den Schall weit nuancierter überträgt. Sofern Euterpe, die Muse der Musik, die Künstlerinnen und Künstler küsste, waren sie gleichwohl um transatmosphärische Klänge niemals verlegen: Den Mond besingen wir volkstümlich, aber nie so ergreifend wie in dem Lied, das ihm Antonín Dvořák in seiner Oper „Rusalka“ widmete. Zwar wissen wir nicht, „wie viel Sternlein stehen“, doch der französische Frühimpressionist Henri Duparc führt uns in einer wunderbaren Tondichtung „Aux étoiles“, zu den Sternen. Gustav Holst, in seinen „Planeten“, lässt den Merkur erst mal links liegen, um seine berühmte Orchestersuite martialisch gleich mit dem Mars anheben zu lassen, dem „Bringer des Kriegs“. 1914, als der Erste Weltkrieg entbrannte, hatte der Brite mit der Komposition begonnen, 1918 wurde sie uraufgeführt – im selben Jahr, in dem der Däne Rued Langgaard ein Großwerk für ein geradezu universales Instrumentarium abschloss, Orchesterkunst von einer kosmischen Weite des Klangraums, voll außerweltlicher Ruhe und solarer Explosionen. Der Titel: „Sphärenmusik“. ■
Blüte und Pleite
Dienstag, 23. Februar Mit dem Knaben Hanno kommt das Ende. Ein Buddenbrook ist er nur mehr dem Namen nach. Kein lebenskräftiger Handelsmann nach Art der Vorfahren kann je aus ihm werden. Nicht für Geld und Besitz, fürs Klavier sind seine Hände geschaffen. Mit der Feder zieht er in der Familienchronik einen Strich unter seinem Namen: Nach ihm wird nichts mehr kommen ... Mit Thomas Johann Heinrich Mann kam das Ende. Als der angesehene Lübecker Kaufmann und Senator 1891 starb, wusste er, dass seine Kinder zu Ökonomen nicht taugten. Konsequenterweise liquidierte er seine Firma. So konnten die Söhne Heinrich und Thomas Schriftsteller und zu Protagonisten der deutschen Literatur werden. freilich hatte Thomas Mann genug von der Lebens- und Geistesart hanseatischer Handelsherren aufgesogen, um daraus einen Roman zu machen. Familien gelten als finanzielle Aktiva: Als gut norddeutsche Pfeffersäcke, in denen die Leistungsethik des Protestantismus jeden Tropfen Blut sättigt, glauben die Buddenbrooks, ein erfülltes Sein lasse sich an dem ablesen, was man im Übermaß besitze. Heiraten beschließen und schließen sie, sofern Braut oder Bräutigam als ‚gute Partie‘ gilt und tadelfrei das Renommee der Sippe hebt. Die scheitert zwangsläufig an der gründerzeitlichen Epochenwende, die der überständigen Hochwohlgeborenheit den Garaus macht und nach der sich merkantile Integrität nicht mehr in barer Münze auszahlt. Den „Verfall einer Familie“ studiert Thomas Mann in dem Wälzer, der in der Gesamtausgabe 750 Seiten umfasst; umso bündiger, wie buchhalterisch, wählte er als Titel schlicht den Namen des Großbürger-Clans, dessen Spätblüte, Firmenpleite und Marginalisierung er so stilvoll wie anschaulich, nicht minder mokant als bewegend nachvollzieht. Ein wimmelndes Figurenpanorama, ein Zeitpanorama von enormer Spannweite: In über vierzig Sprachen übersetzt, fand das frühe Meisterwerk bis heute weltweit wohl über fünf Millionen Käufer. Damit war nicht gleich zu rechnen, denn der Absatz verlief zumindest anfangs schleppend. Bislang hatte Mann erst mit ein paar Novellen ein wenig Eindruck gemacht. Nun bot er das gewaltige Konvolut beschriebenen Papiers dem bedeutenden Verleger Samuel alias S. Fischer an. Wirklich hielt der viel vom Stoff und von dessen Gestalter. Indes: ein so unerfahrener Schriftsteller – und gleich eine Saga von solcher Weitschweifigkeit? Also schlug Fischer vor, die Hälfte zu streichen. Das komme nicht infrage, beschied ihn der Jungdichter selbstbewusst. Der Verleger gab nach und riskierte viel: Vor 120 Jahren, am 26. Februar 1901, erschien das Werk in zwei Bänden – die sich kaum verkaufen wollten. Schon glaubte Fischer seine Bedenken bestätigt, durfte sich dann aber doch, mit der nun einbändigen Zweitauflage, über einen Best- und Longseller freuen. Als die Nobel-Jury Thomas Mann den Literaturpreis für 1929 zusprach, galt die Ehrung übrigens nicht etwa dem seit fünf Jahren gefeierten „Zauberberg“, sondern ausdrücklich – und fast kränkend für den spätestens mit jenem chef-d'œuvre ausgewachsenen „Großschriftsteller“ – den „Buddenbrooks“. Der Dichter spürte Wehmut; und verwand sie: Der Preis, resümierte er, habe „wohl auf meinem Wege“ gelegen. Ein „außerordentlich deutsches Buch“ nannte er später sein Debüt und meinte stolz – und nicht zu Unrecht –, er habe, kaum 26-jährig, in ihm „schon alles gegeben“. ■
Alles höchst edel
Samstag, 20. Februar Besucher hatten keinen Grund zu klagen. Noch bevor der Dichterfürst ihnen die Ehre seines leibhaftigen Auftritts erwies, ließ er sie wissen, dass sie willkommen seien. „Salve“ lasen sie auf der Schwelle, die zu Johann Wolfgang von Goethes Gemächern führte: Sei gegrüßt. Mit Zeitgenossen, die ihm gebührend Achtung erwiesen, tauschte er sich gerne aus, befleißigte er sich doch in seinem Heim gern der „Verbreitung von Kunst und Wissenschaft“. Unter einen Kupferstich, der das Haus am Weimarer Frauenplan zeigt, reimte er: „Warum stehen sie davor? / Ist nicht Türe da und Tor? / Kämen sie getrost herein, / Würden wohl empfangen sein!“ Wirklich reißt der Strom der Neugierigen und Zudringlichen (auch wenn das Coronavirus ihn seit 2020 stark ausdünnt) nicht ab. Bis 2025 soll das auch so bleiben, dann nämlich feiert Weimar die 250. Wiederkehr des historischen Augenblicks, da der 26-jährige Goethe, noch kein Dichterfürst, gleichwohl schon eine Berühmtheit und als solche von Herzog Carl August herbeigewünscht, in der Stadt anlangte. Als er 1832 sein Leben in ihr beschloss, hatte er ein halbes Jahrhundert am Frauenplan gelebt. In den Westteil des Anwesens war er 1782 zunächst als Mieter eingezogen; 1794 vermachte der Duodez-Regent es ihm großzügig im Ganzen als Geschenk. Heute gehört es mitsamt vielen originalen Möbeln und Ausstattungsgegenständen sowie den üppigen Sammlungen zum Unesco-Welterbe. Nach dem Jubeljahr, von 2026 an, werde das Haus saniert, teilte dieser Tage die Klassik-Stiftung mit. An Eingriffen in die Bausubstanz hat es nie gefehlt. 1709 errichtete es ein fürstlicher Kammerkommissar und Strumpfverleger namens Georg Caspar Helmershausen als Großbürgerdomizil. Goethe ließ es gründlich umbauen, einerseits um sich private Ungestörtheit für seine gelehrten Ambitionen zu schaffen, wofür er die Räume des Hinterhauses, dazu seinen „Klostergarten“ vorsah; zum andern schuf er im vorderen, der Straße zugewandten Trakt Platz für angemessene Repräsentation. Dem ergebenen Adlatus und Gesprächs-Dokumentaristen Johann Peter Eckermann gefiels: Er fand beim ersten Aufenthalt „alles höchst edel und einfach, ohne glänzend zu sein“. Ein Urteil sicher ganz in Goethes Sinn: Prunken wollte er nicht; freilich, herzeigen, was er hatte – das tat er schon gern. Und er hatte viel: allein 26 000 Kunstobjekte, dazu eine gut sortierte Bibliothek von 6500 Bänden; 23 000 naturwissenschaftliche Präparate, davon 18 000 Mineralien, füllten einen Gartenpavillon an der Grundstücksgrenze. „Nicht leicht wird jemals so vieles und so Vielfaches interessantester Art bei einem einzigen Individuum zusammenkommen“, staunte und prahlte Goethe selbst. Derzeit unterbindet Sars-CoV-2 den Besuch des 1886/87 hier etablierten, nach Behebung der Weltkriegsschäden seit 1949 wiedereröffneten Goethe-Nationalmuseums; in fünf Jahren schließt es der Bauarbeiten wegen wiederum, dann für mindestens zwei Jahre. Dennoch lassen sich die achtzehn geistgesättigten, atmosphäredichten, biedermeierlich wohnlichen Räume der Ausstellung in aller Ruhe durchschreiten: Im Internet ist man „zu Gast bei Goethe in 360°“. Gleichsam auf seinen Spuren gleitet man via Maus wie auf leisen Filzpantoffeln durch die Schauräume und das Privatissimum. Es ist, als ob der Dichter online „Salve“ sagte. ■
Dienstag, 16. Februar Bevor die Tänzerin sein Herz gewann, sorgte sie dafür, dass er Stielaugen bekam. Eine (wohl böswillige) Überlieferung besagt, dem König habe der erste Anblick ihres ansehnlichen Busens die Sprache verschlagen: „Natur oder Kunst?“ brachte er, zweifelnd, gerade noch heraus. Da soll die gelenkige Beauté behände ihr Bustier aufgeschnippelt haben, und Bayerns erster Ludwig durfte sich überzeugen: An Lola Montez war alles dran und alles echt. Auf den Wahrheitsgehalt der Anekdote geben Geschichtskenner nicht viel, so greifbar wie humoristisch aber umreißt sie die Grundsituation. Brav, nicht treu war Ludwig mit seiner Therese verheiratet, hatte hübsche Frauen die Menge verehrt und genossen und mit Porträts der attraktivsten eine erlesene „Schönheitengalerie“ arrangiert. Dann forderte Lola Montez den schon Sechzigjährigen noch einmal zu Eruptionen sowohl der Wollust wie seines Ehrgeizes als dilettierender Dichter heraus: Im Herbst 1846 trat ihm die Hochstaplerin, Herzensbrecherin und Hetäre erstmals entgegen, die vor zweihundert Jahren, am 17. Februar 1821, als Elizabeth Gilbert im nordwestirischen Grange zur Welt gekommen war. Als rassige Ballerina, mit iberischem Pseudonym und einem geradebrechten Spanisch auf den Lippen, verdrehte sie den Männern, namentlich solchen von Adel, Geld und Einfluss, die Köpfe. Der Ranghöchste unter ihnen, der König im Bayernland, belohnte ihre unermüdlichen Gunstbeweise mit sündteuren Geschenken, darunter einem Palais. Auf Zustimmung stieß er damit weder bei seinen Ministern noch bei seinem Volk. Empörung kochte hoch, als er die menschenverachtend mit der Reitpeitsche um sich schlagende, schon als Zigarrenraucherin anstößige Kurtisane zur Gräfin erhob. Dass das Bett, das sie für den König wärmte, zwischendurch auch andere Liebhaber durchquerten, pfiffen die Spatzen von den Dächern. Ludwig indes vertraute ihr: „Wenn der Schein auch trüget, / du bist getreu, und du bist immer wahr“, sang der poetische Potentat in blinder Liebesblödigkeit. Vor den Münchnern, die sie auf der Straße offen als Hure beschimpften, sich sogar zum Protest zusammenrotteten, beschützte Militär die „unaussprechliche Frau“ mit blankem Säbel. Die wohl beiderseits von Zuneigung getragene, freilich immer schmuddeliger anzusehende Affäre wuchs zur innenpolitischen Krise sich aus. Mit knirschenden Zähnen verfügte Ludwig schließlich Lolas Ausweisung aus dem Königreich; unter Mitnahme eines ihrer Lover und einer beträchtlichen Apanage verzog sie in die Schweiz. Dann kam, 1848, die Revolution. Gegen den Willen des von Machtschwund bedrohten Regenten stand Lola plötzlich unter Haftbefehl. Und überhaupt verlor Ludwig die Lust, zumindest am Regieren: Am 20. März trat er zurück. „Die Sylphide / mit den blauen / Augen hell und klar“ abenteuerte über den Atlantik, spielte am New Yorker Broadway auf der Bühne sich selbst, wurde fromm und erlag einen Monat vor ihrem vierzigsten Geburtstag ebendort einer Lungenentzündung. „Pfuy Teufel, Königshaus“, hieß es auf dem Höhepunkt des Skandals in einem Pamphlet, „bringst uns in Schand und Spott. / Helf uns der liebe Gott.“ Maximilian half, Ludwigs Sohn und Nachfolger auf dem Thron, als Persönlichkeit vergleichsweise blassgrau, aber verlässlicher bei Verstand als der Papa. Dem verdankt München immerhin viel noble Baukunst und eine der schönsten Klatschgeschichten aus der Welt gekrönter Häupter. ■
Tanz nach der Pfeife
Samstag, 13. Februar Was uns Menschen vor der übrigen Fauna einzigartig mache – darüber gehen die Ansichten weit auseinander. Manche sagen, es sei der aufrechte Gang; die Komplexität unseres Gehirns; die Sprache; die Fähigkeit, Werkzeug zu gebrauchen … Aber sind wir denn allein damit? Raben etwa oder auch Delphine verblüffen uns durch ihre Intelligenz, auch mancher Nager, Affe, Hund läuft gern mal auf zwei Beinen, Wale kommunizieren sehr differenziert, Werkzeuge verwenden manche Vögel und Otter auch … Besonders macht uns wohl, dass wir von alledem so viel auf uns vereinen. Mit den Affen teilen wir den Vorzug, über einen Daumen zu verfügen. Indem wir ihn den übrigen vier Fingern gegenüberstellen, eröffnet sich unserer Hand ein reiches Repertoire an Möglichkeiten, fest oder fingerspitz, zärtlich oder mordend zuzugreifen. Oder Musik zu machen: Auf dem Klavier schlagen wir leicht acht, neun, zehn Töne miteinander an; oder wir bescheiden uns mit einem Flötenton. Das taten unsere jungsteinzeitlichen Vorfahren schon vor 50 000 Jahren. So alt ungefähr ist das älteste bekannte Blasinstrument; in Slowenien wurde es aus einem Bärenknochen geschnitzelt und gebohrt. Etwa zehntausend Jahre später entstand eine Flöte mit drei Löchern, die den vorgeschichtlichen Bewohnern des Geißenkösterles, eines Felsüberhangs bei Blaubeuren, das Spiel von Tonfolgen erlaubte. Vor 35 000 Jahren erklang eine Elfenbeinflöte im gleichfalls baden-württembergischen Lonetal. ‚Nur‘ etwa halb so alt, 18 000 Jahre nämlich, ist das gewundene Haus der Charonia lampas, einer Tritonschnecke aus dem Ozean, das nahe der winzigen Pyrenäengemeinde Marsoulas im südlichsten Südfrankreich auftauchte: Gefunden wurde es schon 1931 in einer Höhle voller prähistorischer Felsmalereien; doch jetzt erst zeigte sich, dass das gut dreißig Zentimeter lange, farbig dekorierte Kalkgehäuse geeignet, wenn nicht eigens dafür angefertigt worden ist, Töne preiszugeben. Angeblasen wurde es über die absichtsvoll entfernte Spitze; weitere Öffnungen erlaubten, die Tonhöhe zu variieren: Einem zurate gezogenen Hornisten gelangen ein C, ein Cis, ein D. Das Artefakt lässt ahnen, dass wir Menschen bereits nach der Pfeife tanzten, als unsere Kultur noch in sehr kleinen Kinderschuhen steckte. Selbst Tiere, denen wir ein gewisses Faible für Musik zuschreiben, besagte stimmsonore Wale und zwitscherndes Federvieh, heulende Wölfe oder rhythmisch ratschende Zikaden, benutzen dazu keine Extra-Utensilien, sondern sehen sich auf das verwiesen, was der eigene Körper ihnen zur Verfügung stellt. Sie also, die Musik – und mit ihr alle Kunst, die uns ausdrückt und von uns erzählt –, sondert uns Menschen tatsächlich von den Nachbarkreaturen ab. Rechtfertigt das indes den Dünkel, mit dem wir uns die Natur unterwerfen? Mark Twain, der notorische Spötter (und Verfasser des „Tom Sawyer“), wollte im Menschen nicht viel mehr erkennen als „das einzige Tier, das errötet und Grund dazu hat“. Wirklich sollten wir uns schämen eingedenk der unheilvollen Weise, mit der wir die geschundene Umwelt gleichsam nach unserer Pfeife tanzen lassen. Für Mutter Erde sind wir eher Fluch statt Segen, gleichwohl geben wir unsere Spezies gern als „Krone der Schöpfung“ aus. Zwar krönen wir unser Dasein als Geschöpfe mit Musik, trotzdem gebührt der angemaßte Ehrentitel uns nicht. Der Zelle steht er zu und allenfalls dem Ei. ■
Unheilige Jungfrau
Dienstag, 9. Februar Eigentlich ist es Mord. Aber Liebe ist es auch. Zwischen Sex und Sehnsucht unterscheidet Salome nicht. Einem heiligen Mann huldigt die halbwüchsige Jungfrau – die kurz nach der Zeitenwende als Prinzessin am Hof des judäischen Königs Herodes Antipas im antiken Palästina ihr Leben vertändelt –, aber sie vergöttert den Warner auf ihre sehr eigene Weise: nicht in aller Andacht, sondern als Verführerin, mit ihrem Leib, nicht mit der Seele. Von dem Propheten abgewiesen und sogar verflucht, schlägt sie den einzigen Weg ein, der sie noch zu ihm führen kann: Sie bringt ihn ums Leben. Dann gehört er ihr ganz. Das Haupt lässt sie dem Eingekerkerten abschlagen und sich triefend auf einem Tablett bringen, um es zu liebkosen, während sie ihm unstillbar die Glut ihrer Leidenschaft bekennt. Die keuscheste Form der Hingabe – und wahrlich, die obszönste auch. „Ah! Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan“, jubelt sie in ihrer Lust. „Es war ein bitterer Geschmack auf deinen Lippen. Hat es nach Blut geschmeckt? Nein! Doch es schmeckte vielleicht nach Liebe ... Sie sagen, dass die Liebe bitter schmecke.“ Theaterfreunde kennen die faszinierend schaudervolle Szene aus Richard Strauss’ Oper um Erregung, Erfüllung und Tod der Salome; 1905 kam der Einakter in Dresden heraus, in damals als unerhört wahrgenommenen neuen Tönen und dissonanten Harmonien, hundert Minuten lang. Die einst von der Zensur als skandalös verurteilten Zeilen des berühmten Schlussgesangs sind hierzulande unter Kennern in den Rang geflügelter Worte aufgestiegen, was auch der Poetin Hedwig Lachmann zu danken ist, deren Übersetzung des Stücks der Komponist zum Großteil und nur wenig abgewandelt seinem Musikdrama zugrunde legte. Das Original indes erblickt weit seltener das Scheinwerferlicht der Bühne. Von Oscar Wilde stammt es, der sich dabei auf die biblische Geschichte vom Martyrium des Täufers Johannes aus dem Neuen Testament bezog. Nicht in seinem Heimatidiom Englisch hatte der Ire es 1891 zuerst herausgebracht, sondern auf Französisch, jener „seltsamen Sprache“, die er liebte, „wie man ein Musikinstrument liebt, das man noch nie gespielt hat“. Vor 125 Jahren, am 11. Februar 1896, erlebte die „Salome“ am Pariser Théâtre de l'Œuvre ihre Uraufführung. Nicht nur die Sprache des Schauspiels, auch das Stück selbst liebte der Dichter: Angeblich achtete er es noch höher als seine vier wunderbar dahinparlierten Lustspiele, mit denen er, als luxusverliebter Dandy, Meister der ironischen Gesprächskunst und glanzvoller Tänzer auf den haarfeinen Seilen des paradoxen Aphorismus, später die viktorianische Gesellschaft hinriss und erheiterte. Sogar ein singulärer Stilartist wie er, Kenner alles Erlesenen, Teuren und Schönen, hat sich nicht oft zu solcher Delikatesse der Diktion, zu so schillernden Phantasmagorien der Symbole, Metaphern und ihrer Farben aufgeschwungen wie hier. Widersprüchlich in grausamer Zartheit und zugleich tödlicher Härte prallen Erkenntnis und Eros, Jochanaans erleuchteter Geist und der leuchtende Leib der unberührten femme farale aufeinander. Wilde stellte sich selbst vor die Wahl, welcher Seite er zuneigte: Den wahnsinnig-weiblichen Part der Salome zog er der moralisch überlegenen, doch dahingemetzelten Männlichkeit vor. Aus dem Jahr 1895 datiert ein Foto, das ihn in den Gewändern und mit den Preziosen der un–heiligen Jungfrau zeigt, niederkniend vor einer Schüssel mit dem Kopf des frommen Künders, nach dem der Künstler begehrlich Arme und Hände ausstreckt. ■
Ein Kraftkerl
Samstag, 6. Februar Eine Leuchte ist er nicht. Er hat keine Atmosphäre, keine Farben, und was wir für sein romantisches Schimmern halten, hat sich der Mond von unserem Zentralgestirn geklaut. Anders als manche seiner Kollegen im Sonnensystem steht er nicht unter dem faszinierenden Verdacht, er könne einfache Lebensformen beherbergen, erst recht hat er keine so schmucken Ringe wie Saturn, auch kein Auge wie der Jupiter und überhaupt wenig, womit sich prunken lässt. Größe schon gar nicht: Fünfzig Mal würde er in unsere Erde passen. Aber eins hat der Mond: Schmackes. Etwa 400 000 Kilometer ist er entfernt und vermag uns doch täglich das Schauspiel von Ebbe und Flut zu bieten, indem er kreisend und kraft seiner Gravitation Abermilliarden Tonnen von Meerwasser hin und her bewegt. Dass der kleine Kraftkerl sich aus sicherer Entfernung auch noch anders Geltung bei uns verschafft, vermuten wir Menschen, seit es uns gibt (also schon immer). Weil der Mond seine „Phasen“ regelmäßig wechselnd durchläuft, nahmen unsere vorzeitlichen Vorfahren ihn als mythisches Sinnbild für Werden, Vergehen und Erneuerung, auch als Symbol für das Regelmaß der Zeit. Immerhin heißt unser Wort Monat nach ihm. Irgendwann freilich verzichteten wir, zu Positivisten gewandelt, darauf, ihm Übernatürliches zuzutrauen, und hielten uns lieber an Statistiken. Die lehrten uns, dass es entgegen dem Volksglauben bei Vollmond nicht mehr Verkehrsunfälle, zwischenmenschliche Konflikte und Geburten gibt und auch nicht mehr Warzen verschwinden oder Operationen misslingen als sonst. Aber der Schlaf als solcher? Da scheint Differenzierung nötig, wie ein Aufsatz in den Science Advances nahelegt. Ein Forscherteam berichtet in dem angesehenen US-amerikanischen Wissenschaftsjournal von einer Studie, an der Angehörige eines indigenen Stammes in Argentinien - die einen ohne, die anderen mit Zugang zu elektrischer Beleuchtung - sowie Probandinnen und Probanden aus der modernen Großstadt Seattle teilnahmen. Das Ergebnis: Eine „Modulation des Schlaftimings durch Mondphasen“, wiewohl vielfach um- oder bestritten, lässt sich durchaus nachweisen. In den Nächten kurz vor Vollmond schlafen wir später und kürzer. Denn bis zur Industrialisierung nutzten unsere Vorfahren das Licht des Mondes zu Fischfang, Jagd und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Weil dies sich so verhält, seit unsere Spezies sich entwicklungsgeschichtlich zu entfalten begann, hat sich das Verhaltensmuster offenbar in unser Erbgut eingebrannt. Woran wir Menschen allerdings während halber Ewigkeiten nicht im Traum zu denken wagten, nämlich den treuen Erdgefährten leibhaftig zu besuchen, das wurde 1969 Wirklichkeit und solls demnächst aufs Neue werden. Thomas H. Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der NASA, gibt die Parole aus: Die USA wollen wieder „zum Mond und dann zum Mars“, und zwar „so schnell wie möglich, mit internationalen Partnern“. Donald Trump, als er noch Präsident war, versprach, es solle 2024 unbedingt auch erstmals eine Frau mit auf die Reise gehen. Dass es im Dezember, kurz vor seiner Abwahl, den Chinesen gelang, von ihrer Sonde „Chang’e 5“ aus eine Flagge ihres Landes auf dem Erdtrabanten zu hissen, wird ihn mächtig gewurmt haben. Bis dato standen dort nur sechs Sternenbannerchen herum, von keiner Bö bewegt. Der Mond ist stark genug, beide Hinterlassenschaften stoisch zu ertragen. ■
Weste mit Flecken
Dienstag, 2. Februar Dieser Mann hat Bedeutung für Millionen, nur wissen die meisten kaum von ihm. Schweizer war er, wurde aber, am Donnerstag vor 125 Jahren, im kaiserlich-königlichen Wien geboren und starb, mit gerade mal 42, in der Nähe des italienischen Genua. Ein braver Bürger wollte Friedrich Glauser sein und kam doch unheilbar vom Morphium nicht los, das ihn gesellschaftlich ins Abseits stellte. Seinen Namen trägt heute einer der bedeutendsten Preise für Kriminalliteratur; selbst aber siegte er, 1934, vier Jahre vor seinem Tod, lediglich beim Kurzgeschichtenwettbewerb einer Zeitung. Danach erst kamen, binnen Kurzem und in der Mehrzahl nach seinem Tod, seine eigenen einschlägigen Romane in Buchform heraus; und verschwanden wieder vom Markt. Unzählige Menschen begannen, Krimis zu lesen und zu lieben, aber Glausers Geschichten um den kant- und kauzigen Wachtmeister Studer bekam man bis in die Achtzigerjahre allenfalls antiquarisch vor Augen. Unstet, beschwerlich, demütigend oft verlief das Leben des Schriftstellers, der bereits als Siebzehnjähriger eine Serie von Selbstmordversuchen begann. Deshalb und wegen Handgreiflichkeiten mit einem Lehrer flog er aus einem Wiener Gymnasium. Zwanzigjährig nahm er in Zürich ein wüstes Bohèmedasein auf, das weit mehr Geld verschlang, als er besaß. Weil sich sein Verhalten den allgemeinen Normen und der väterlichen Erziehung nicht beugte, ließ der Papa den „liederlichen und ausschweifenden“ Filius entmündigen, der die Mutter bereits als Vierjähriger verloren hatte. Mit Entzugskliniken und Gefängniszellen schloss er etwa ab seinem 25. Jahr Bekanntschaft. Die französische Fremdenlegion entließ ihn nach zwei Jahren, einer Malaria-Erkrankung und eines Schadens am Herzen wegen. Gleichwohl legte die Soldatenzeit mittelbar den Grundstein für seine Laufbahn als Erzähler: Unter Kriegern in Südmarokko spielt sein erster Roman „Gourrama“, den er erst sieben Jahre nach dem Abschied von der Söldnerarmee abschloss. Seinen Nachruhm aber verdankt er der Reihenfigur des Jakob Studer, den er nicht als souveränen Verbrechensbekämpfer mit weißer Weste ausgestaltete; vielmehr fristet der alternde, nie höher als zum Wachtmeister beförderte Beamte selbst eine eher randständige Existenz, hatte er doch einst bei irgendeinem dunklen Geldgeschäft die Finger im Spiel. Mithin steht er den halbweltlichen Milieus und menschlichen Niederungen, in die er sich in fünf Büchern begibt, näher, als so manche literarischen Kollegen aus anderen Federn der Zeit es tun, die durch Furcht- und Tadellosigkeit unweigerlich ans Ziel gelangen; mit einem sympathischen Schnösel wie dem Hercule Poirot der Agatha Christie zum Beispiel verbindet ihn wenig, immerhin die Intuition. Mit Studer modellierte Glauser musterhaft einen der Urtypen des deutschsprachigen Krimi-Kriminalisten. Als für den Autor ein Durchbruch und privates Glück endlich greifbar schienen – er hatte das Herz einer Frau gewonnen –, wich er, ob gewollt oder nicht, in den Tod aus: Am Abend vor der Hochzeit erlitt er, wahrscheinlich nach Einnahme einer Überdosis Schlaftabletten, einen Gehirnschlag, brach sich beim Niederstürzen den Schädel und fiel ins Koma, aus dem er nicht wieder erwachte. Indem die Nachwelt einen Preis nach ihm benannte – den „Glauser“ verleiht seit 1987 die Autorengemeinschaft „Syndikat“, 2013 erhielt ihn der Hofer Roland Spranger für „Kriegsgebiete“ –, ehrte sie ihn postum höher, als ein Preis es zu Lebzeiten vermocht hätte. ■
Die Stadt Z
Samstag, 30. Januar Es gab eine Zeit, und so lange ist sie nicht her, da war Abenteuer noch kein freizeitlicher Trendsport für Adrenalinjunkies auf der Suche nach dem nächsten „ultimativen Kick“, sondern eine existenzielle Entscheidung von Männern und Frauen, die es wissen wollten: nämlich was sie, als Winzlinge, mit dem gewaltigen Ball im All, der Erde, anfangen könnten. Das war die Zeit, als es noch „weiße Flecken“ in den Atlanten gab, Symbole für Weltgegenden, die kein sogenannter zivilisierter Mensch betreten, geschweige denn inspiziert hatte und die darum auf den Karten als Leerräume ohne grafische Signaturen aufschienen. Mag sein, dass es damals einfacher war, ein veritables Wagstück zu erleben; oft aber war es mit Risiken für Leib und Leben verbunden, so wie heute der verwegene Absprung im wingsuit, einem „Flügelanzug“, aus einem Flugzeug oder das draufgängerische free climbing eine tausend Meter hohe Steilwand hinauf. Viele Entdecker, die Fernweh, Forscherehrgeiz und Abenteurermut in sich vereinten, fanden, wo sie nach Exotik, Kostbarkeiten, Bodenschätzen suchten, den Tod. So auch Percy Fawcett: Der britische Artillerieoffizier, seiner Heimat und des Militärdienstes überdrüssig, machte sich von 1906 an sieben Mal nach Südamerika zum Amazonas auf, dem größten Fluss der Welt. Ursprünglich machte er sich für die Royal Geographic Society auf den Weg, um die umstrittene Grenzlinie zwischen Brasilien und Bolivien festzulegen und die noch kaum sondierte Region des Mato Grosso zu kartografieren, einen der letzten der besagten weißen Flecken. Dann aber verlagerte sich Fawcetts Eifer: In Rio de Janeiro war er auf Notizen von Glücksrittern aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gestoßen; die wollten, so las er, bei ihren Raubzügen im Regenwald auf breite Straßen und mächtige Plätze, verlassene Luxushäuser aus Stein und den leeren, aber weitläufigen Regierungssitz eines Herrschers gestoßen sein. Fawcett war elektrisiert: eine vergessene Hochkultur – im Dschungel, der doch als unbesiedelbar galt? Die Aufzeichnungen schienen zu bestätigen, was ihm auf seinen Expeditionen wiederholt Eingeborene zugeraunt hatten. „Z“ nannte er die Stadt, die er wahrscheinlich nie gesehen hat und die es vielleicht gar nicht gibt. Denn bis heute fehlt jede Spur von ihr. Als Spinner tat man Fawcetts Visionen in der Heimat ab, dennoch ging er während mehrerer Jahre allen Hinweisen nach – und ging verloren. Seit dem Sommer 1925 gibt es keine Nachrichten mehr von ihm und seinem Sohn; manches spricht dafür, dass Indigene sie ermordeten. Für den sympathisch-unbesiegbaren Kinohelden, den Harrison Ford zwischen 1981 und 2008 in der „Indiana Jones“-Tetralogie verkörperte, diente Fawcett als Urbild; freilich hatte er mit der burschikosen Brachial-Archäologie des fiktiven Leinwand-Weltenbummlers nichts zu tun. Nicht zuletzt wegen seines ungewissen Schicksals wurde „Die versunkene Stadt Z“ zum Mythos, den Journalisten und Kinoregisseure am Leben hielten. Nach einem Buch des US-Autors David Grann drehte dessen Landsmann James Gray 2016 den Film gleichen Namens, den das Kulturfernsehen Arte am Sonntag um 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere ausstrahlt. Längst finden sich im Atlas keine weißen Flecken mehr, dafür gibt es sie in unendlicher Vielzahl auf dem gerade mal zu fünf Prozent erkundeten Meeresboden – und im All. Was es heißt, dort ein Abenteuer zu wagen, beschreibt das Fernsehen ebenfalls am Wochenende: am Samstag um 20.15 auf Vox in Damien Chazelles „Aufbruch zum Mond“. ■
Dicke Köpfe
Dienstag, 26. Januar Schade, dass er den Satz nicht wirklich gesagt hat. Dabei klingt er so schön: so unumwunden todesmutig, charaktervoll konsequent. Kein Wunder, dass er sich als beispielhaft trutzige Redewendung und wohl populärstes Wort Martin Luthers schon ein halbes Jahrtausend lang im üppigen Zitatenschatz der Nation hält. Er verlange, insistierte der mit dem Feuertod bedrohte Reformator, dass seine in Predigten und Drucksachen geäußerte Kritik an der katholischen Lehre und dem Papsttum nur aufgrund biblischer Aussagen widerlegt werde; denn in christlichen Glaubensfragen erkenne er allein die Heilige Schrift als Autorität an. „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen“, hätten, so die Überlieferung, seine Schlussworte schicksalsergeben gelautet. „Hier“ – das hieß: in Worms. Dorthin hatte der 21-jährige deutsche, wenn auch des Deutschen kaum mächtige Kaiser Karl V. den Unruhe stiftenden, nun allerdings eingeschüchterten Gottesmann beordern lassen, nicht etwa, um über dessen umstürzlerische Ansichten zu debattieren; vollständigen Widerruf vielmehr forderten der Monarch und seine Berater. Dass es dazu nicht kann, haben nicht zuletzt die unzähligen Veranstaltungen des „Lutherjahrs“ vor vier Jahren allüberall wiedererzählt. Was Luther seinem gestrengen, streng katholischen Herrn an diesem 17. April 1521 wortwörtlich entgegnete, ist dennoch nur wenigen geläufig: „Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“ Auch in dieser Form: ein starkes Stück, solche Weigerung - Bekenntnis eines unbeugsamen Dickkopfs. Eingedenk des qualvollen Endes, das Jan Hus 1415 auf dem Konstanzer Scheiterhaufen erlitten hatte, ging Luther ein enormes Risiko ein, war doch, wie ihm, einst auch dem böhmischen Theologen freies Geleit zugesagt gewesen. Anders als Hus durfte Luther – mit von Steinlasten befreitem Herzen („Ich bin hindurch!“) – den Ort der Befragung wieder verlassen. Über den Weiterungen, die jene Begebenheiten weltgeschichtlich zeitigten, wird leicht vergessen, dass der Glaubensstreit – so sehr er dem Kaiser wie dem unbotmäßigen Gottesknecht auf den Nägeln brannte – keineswegs allein auf der Agenda des Wormser Reichstags stand. Die Zusammenkunft, die am Mittwoch vor 500 Jahren (und drei Wochen nach der Aachener Kaiserkrönung Karls) im Bürgerhof eröffnet wurde, befasste sich dringlich auch mit der Ordnung des „Heiligen Römischen“ Gemeinwesens: mit dem „Reichsregiment“ (einem ständischen Regierungsorgan), dem Reichskammergericht als oberster Justizbehörde, mit dem „Landfrieden“, also den Beschränkungen von Fehdewesen und Selbstjustiz, mit der Aufteilung von Militärausgaben. Gleichwohl blieb das Thema Luther gravierend. Dickköpfig, nämlich unbelehrbar und unnachgiebig wie der „Ketzer“, zeigten sich auch die versammelten hohen Herrschaften: Unterm Datum des 8. Mai verhängten sie mit dem „Wormser Edikt“ die Reichsacht über ihn, verboten die Publikation seiner Schriften und sogar deren Lektüre. Da freilich hatte der Religionsrebell, als Junker Jörg hinter den sicheren Mauern der Wartburg verborgen, längst die wirkmächtigste, grundstürzendste seiner Schriften in Angriff genommen: die Übersetzung der Bibel in deutsche Sätze, die jeder im Lande verstand. ■
Busen im Dunst
Samstag, 23. Januar Bis heute verwalten die Vereinigten Staaten, ihrer florierenden Porno-Branche ungeachtet, das Erbe puritanischer Keuschheit mit absurder Zimperlichkeit. Als 2004 in Houston während der Halbzeitpause des über alle TV-Kanäle übertragenen super bowl Janet Jackson und Justin Timberlake ein Duett sangen, riss der Sänger (vereinbarungsgemäß) der Sängerin einen Teil ihres Kleids vom Leib, wodurch er (angeblich unbeabsichtigt) eine von Jacksons Brüsten mitsamt Piercing freilegte, nur für einen Moment. Der aber versetzte die Nation in Aufruhr. Auf breiter Front riefen Gut- und Wutbürgerinnen „im Namen aller US-Bürger“ nach „maximaler Bestrafung“ wegen der Zurschaustellung „expliziter sexueller Handlungen“. Sie fürchteten bleibende seelische Schäden für ihre fernsehenden Kinder, die offenbar zum letzten Mal bei der Entnahme mütterlicher Milch einen weiblichen Busen erblickt hatten und es wohl bis zur Hochzeitsnacht nicht wieder tun sollten. Unterm frivolen Namen nipplegate ging das Ereignis in die Geschichte des Fernsehens ein, das freilich schon 2004 weit erotischere Situationen weit „expliziter“ zur besten Sendezeit zeigte. Auf der Kinoleinwand sind vergleichbare Anstößigkeiten bedeutend älter, wofür hierzulande ein „Skandalfilm“ mit bezeichnendem Titel steht. Siebzig Jahre liegt es jetzt zurück, dass sich Hildegard Knef als „Die Sünderin“ dem gut- und wutbürgerlichen Publikum zum Fraß vorgeworfen sah: In dem von Willi Forst inszenierten Herzschmerz-Stück lässt die Schauspielerin und Chansonnette für ein paar Augenblicke ihre entblößte Oberweite wie durch einen Dunst hindurch sehen – was in deutschen Lichtspielhäusern bis dato nicht nur nicht üblich war, sondern als Ungeheuerlichkeit für Aufregung sorgen musste. Zum „Skandal“ indes reichte die aufblitzende Nacktheit allein dann doch nicht. Was den Film bei und nach seiner Uraufführung im Januar 1951 in Frankfurt zum Eklat – und zur Sensation – werden ließ, war der Umstand, dass er gleichzeitig mit noch vier weiteren Zumutungen aufwartete: Knef spielte eine gefallene Unschuld, die sich als Dirne verdingt, zwar einem Maler zuliebe dem Gunstgewerbe den Rücken kehrt, sich aber neuerlich verkauft, als ihrem Retter das Geld für eine Tumoroperation fehlt; nachdem der Eingriff missraten ist, hilft sie dem Erblindeten, auf seinen Wunsch hin, mit Schlaftabletten beim Sterben; und nimmt sich schließlich selbst das Leben. Prostitution und freie Liebe, aktive Sterbehilfe und Suizid, alles mit einverständiger Nachsicht dargestellt: Da rüsteten Geistliche mit Stinkbomben hoch, Kirchenvertreter quittierten ihre Mitarbeit bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), Polizei unter Waffen setzte in Regensburg energisch ein Vorführungsverbot der Obrigkeit durch … Zwar kam kritischen Betrachtern das Melodram schon damals reichlich kitschig vor; doch warb das mediale und politische Spektakel darum herum so schlagkräftig dafür, wie sichs die Produktionsfirmen Deutsche Styria und Junge Film-Union nur wünschen konnten: Vier Millionen Deutsche wollten sich unbedingt selbst einen Eindruck von der Monstrosität verschaffen – die Kinokassen klingelten nicht, sie schepperten. Der Karriere der seinerzeit 25-jährigen Aktrice tat das wirtschaftswunderliche nipplegate bleibenden Schaden nicht an. Heute bringt das Schnülzchen nicht mal mehr Fünfzehnjährige aus der Ruhe, und die FSK macht keine Bedenken mehr geltend, wenn Kids ab zwölf es noch vor der Hochzeitsnacht sehen. ■
Schlüsselfragen
Dienstag, 19. Januar „Ja, so warns“, die Krieger des Mittelalters, zumindest wenn es nach Karl Valentin geht. Der sang in einer seiner deftigen Strophen wie folgt: „Ging ein Ritter mal auf Reisen, / legt’ er seine Frau in Eisen. / Doch der Knappe Friederich, / hatte einen Dieterich.“ Mit Versen wie diesen benannte der bayerische Volkskomiker auf seine Weise die Angemessenheit eines ausgelebten Eros als eine der Schlüsselfragen menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Die Zeilen deuten an, wie beträchtlich sich für einen abenteuernden Eroberer der amouröse Anreiz erhöht, sobald es gilt, vor dem Eintreffen bei der Geliebten Hürden, Hinder- und Hemmnisse zu überwinden. Für sie wählte Valentin das besagte und besungene „Eisen“ nur als eines von vielen möglichen Beispielen. Damit gemeint ist der Keuschheitsgürtel um den Schoß der mediävalen Strohwitwe, der zwar nicht den Zugang zu ihr selbst, wohl aber den zu fleischlichen Freuden mit ihr unterbindet. In Gebrauch ist dergleichen längst nicht mehr und bestenfalls noch in Kuriositätenmuseen zu belächeln. Gleichwohl ergeben sich gelegentlich Gelegenheiten, in aller Öffentlichkeit mit historischen Verriegelungsvorrichtungen ähnlich intimer Provenienz bekannt zu werden. So berichtete vor wenigen Tagen die Nachrichtenagentur AFP, das britische Auktionshaus Sotheby’s habe den Schlüssel versteigert, der einst mitten ins Schlafzimmer Napoleon Bonapartes führte. Zwar öffnete er nicht das Gemach, das der Kaiser und notorische Kriegsführer in seiner Pariser Residenz benutzte, wohl aber das an seinem letzten Aufenthaltsort, dem Longwood House auf der Vulkaninsel St. Helena; dorthin hatten die Briten den Entthronten 1815 auf seine letzte Reise und in die unwiderrufliche Verbannung geschickt. Mickrige dreizehn Zentimeter misst das vermeintlich gleichgültige Stück Altmetall, das Sotheby’s dennoch für etwa 15 000 Euro auslobte – und um das sich elf Kunden ritterlich eine Bieterschlacht boten. Der sie für sich entschied, zahlt nun 92 000 Euro dafür. Nur scheinbar eine horrende Summe; andere Nachrichten aus der Versteigerungsbranche pflegen noch ganz andere Beträge zu vermelden. So brachte das Pariser Unternehmen Artcurial vor wenigen Tagen das Original des Comic-Covers unter den Hammer, das der belgische „Tim und Struppi“-Autor und -Zeichner Hergé für den Band „Der blaue Lotos“ schuf: 3,2 Millionen Euro brachte es ein. Für ein „Batman“-Heft, das 1940 für zehn Cent über die Zeitschriftenladentheke ging, löhnte ein Unbekannter jetzt gar 1,8 Millionen Euro. Und selbst dies lässt sich toppen: zum Beispiel durch das Skelett eines „Stan“ genannten, vier Meter hohen und zwölf Meter langen Tyrannosaurus Rex, das einem Käufer im vergangenen Oktober den Rekordbetrag von etwa 27 Millionen Euro wert war. Trotz der Unscheinbarkeit, die gegen des Kaisers vergleichsweise superkurzen Kemenatenschlüssel zu sprechen scheint, erkennt David MacDonald, Antiken-Experte bei Sotheby‘s, „etwas sehr Mächtiges“ darin: einen stummen Zeugen vom Rand der Weltgeschichte. Amouröses zwar trug sich in Napoleons südatlantischer Nickerkammer wohl nicht zu; fest steht indes, dass der Usurpator in ihr endgültig entschlief. So versinnbildlicht jener sündteure „Dieterich“, dass die beiden Schlüssel-Momente jeder Existenz, Eros und Thanatos, Liebe und Tod, höchstems dreizehn Zentimeter voneinander entfernt sind. ■
Eckpunkte-Archiv 2020
Geschenkte Töne
Donnerstag, 24. Dezember Meist findet ein Geburtstagsständchen in privatem Rahmen statt. Gatte und Kinderschar singen es daheim aufgekratzt für die Mama, Freundinnen und Freunde hingebungsvoll einem oder einer aus ihrem Kreis im Nebenzimmer eines Lokals. Bei Personen des öffentlichen Lebens hingegen ziehen derlei klingende Präsente mitunter das Interesse der Allgemeinheit auf sich, wenn nicht gar das eines globalen Publikums. So wars am 19. Mai 1962 in New York, als Marilyn Monroe im Madison Square Garden John F. Kennedy singend zum Fünfundvierzigsten gratulierte. „Happy Birthday, Mister President“, hauchte sie mehr brünstig als inbrünstig ins Mikrofon und die Fernsehkameras, schenkte ihm gleichsam sich selbst – und trat einen unvergessenen Skandal los. Ein knappes Jahrhundert zuvor hatte auch Cosima von Bülow Anstoß erregt, Tochter Franz Liszts und Ehefrau eines der berühmtesten Dirigenten der Zeit. 1867 verließ sie den Gemahl und lebte fortan mit Richard Wagner zusammen, einem der berühmtesten Komponisten aller Zeiten. Eine Tochter hatte sie ihm schon zwei Jahre zuvor geboren und war erneut von ihm schwanger. Über all das wurde, natürlich, in höheren Kreisen weidlich geklatscht; aber zu Aufruhr, Paukenschlag, Spektakel reichte es nicht. Ein knappes halbes Jahr nach der Hochzeit des unorthodoxen Paars, am 1. Weihnachtsfeiertag 1870 und also vor genau 150 Jahren, verehrte der dichtende Tonsetzer seiner frisch Angetrauten ein orchestrales „Idyll mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang“ und intonierte es mit Musikern aus Zürich auf der Treppe des Hauses, das die beiden im schweizerischen Tribschen bewohnten. Die so putzig betitelte Liebesgabe war kein leicht verspätetes Weihnachtsgeschenk, sondern ein leicht verspäteter „symphonischer Geburtstagsgruß“ – an Heiligabend war Cosima 33 Jahre alt geworden. Zwar setzte Wagner sein 19-minütiges Werk kokett als „Gelegenheitskomposition“ herab, doch ging es widerstandslos ins Repertoire und in die Musikgeschichte ein. „Siegfried-Idyll“ nannte mans bald, weil der Komponist darin Motive aus seiner dritten „Ring“-Oper, „Siegfried“, wohltuend ins Kammermusikalische übertragen hatte. Was Cosima am Leib trug, als sie die tönende Huldigung des Gatten gerührt entgegennahm, verschweigt die Historie. Hingegen ist weltbekannt, wie sinnenverwirrend das glitzernde Jean-Louis-Kleid aus beinah transparenter Seide wirkte, in das Marilyn Monroe (ohne ‚was drunter‘) sich hatte einnähen lassen, um vor aller Welt als vorgeblich heimliche Geliebte des Präsidenten ihren Ruf als Sexsymbol zu vollenden: So eng wie ihre Haut lag der Stoff ihrem Körper an und hatte auch etwa deren „Nude“-Farbe. Als die Robe 2016 in Los Angeles versteigert wurde, war sie einem Museum umgerechnet 4,5 Millionen Euro wert. Glück brachte Monroes begehrlicher Glückwunsch allerdings weder dem Staatsmann noch der „Sexbombe“: Kein Vierteljahr später starb sie, vermutlich von eigener Hand, im Jahr darauf wurde Kennedy ermordet. Abergläubische Deuter jener Umstände wundern sich darüber vielleicht nicht: Sein Geburtstag fiel nicht auf den 19., sondern erst auf den 29. Mai – und bekanntlich gelten verfrühte Gratulationen als Quell des Unheils. Hingegen war und ist dem „Siegfried-Idyll“ seit jeher Glück beschieden: Wagner selbst führte das intime Präsent – entgegen Cosimas Einspruch – oft und erfolgreich öffentlich auf. Seither gilt es vielen Klassik- (und nicht nur Wagner-) Fans als eines der schönsten Orchesterstücke der vergangenen 150 Jahre. ■
Blick nach innen
Dienstag, 22. Dezember Lässt sich nicht gerade dieses Bild, auch wenn es nicht als Kunst entstand, wie ein Stillleben deuten, zwar als eines der makabren, aber doch folgenreichen Art? Warum nicht. Auf dem Bild einer besonderen Art Lichtbild aus der medizinischen Wissenschaft - sehen wir: eine entfleischte Hand, über deren viertem Finger ein Ring geschoben ist; fast im Zentrum des Hochformats prangt rund und schwarz ein Fleck; darüber liegt leicht gespreizt ein Zirkel quer. Was kann uns das sagen? Nach dem Symbolgehalt befragt, öffnet das Bild Welten. Namentlich die Hand gibt uns Zeichen, wortwörtlich und im übertragenen Sinn: Eine Hand handelt; sie spendet und überreicht, nimmt aber auch weg; wir drücken uns mit ihrer Hilfe aus, wenn wir, wie oft, ‚mit den Händen reden‘; wir geben einander die Hand in aller Freundschaft oder reichen sie dem Partner, der Partnerin zum Bund; mit ihr winken wir einem und weisen eine andere zurück; wir erheben sie zum Schwur oder ballen sie, im Zorn, zur Faust … Dass es sich in unserem Fall um eine Knochenhand handelt, verweist uns, wie überhaupt ein Gerippe und ein „Knochenmann“, auf unsere Vergänglichkeit, aber auch darauf, dass es unter dem Weichen und Verweslichen noch Haltbares und Haltendes, Tragendes und Stützendes gibt. Im Ring erkennen wir den Kreis und also etwas Unendliches, vielleicht Göttliches wieder; dass es sich um einen Schmuckring handelt, lässt uns mit der Würde oder Eitelkeit des Trägers rechnen. Den Kreis runden wir mit dem Zirkel, wie er ebenso in Albrecht Dürers berühmtem Kupferstich „Melancholia“ von 1514 als Hinweis auf exakte Wissenschaft und Klugheit, aber auch auf Schwermut erscheint. Und die schwarze Scheibe lässt sich als Münze identifizieren, einerseits als Ding von Wert, andererseits als irdischer Tand im Gegensatz zum Besitz, den wir hoffentlich im Himmel haben; Wohlergehen und Segen kann sie signalisieren, desgleichen Pfennigfuchserei oder Verschwendung. In dem Mosaik aus zunächst disparaten Chiffren ahnen wir ein Gesamtbild von vielsagender Hintergründigkeit. Freilich mag, wie sich all das zusammenreimt, jeder für sich selbst ergründen. Denn das Sinn-Bild ist in Wirklichkeit gar keins. 1896 von Conrad Röntgen erzeugt, gibt es eine rechte Hand von innen wieder – die seiner Frau Anna, die der Würzburger Physikprofessor am Dienstag vor 125 Jahren mit den von ihm kurz vorher aufgespürten „X-Strahlen“ zum ersten Mal durchleuchtet hatte. Für die medizinische Diagnostik markiert jener 22. Dezember 1895 eine Epochenwende: Durch Haut und Weichteile hindurch schauten Ärzte fortan auf bislang unsichtbare Knochenbrüche, Fremdkörper und sogar Tuberkuloseherde. Begeistert verlieh die Welt der Wissenschaft den Strahlen schon bald den Namen ihres Entdeckers. 1901, bei der Vergabe der (gleichfalls 1895 begründeten) ersten Nobelpreise, erhielt der Forscher die Auszeichnung für Physik. Was an bildgebenden Verfahren folgte – etwa Ultraschallgeräte, CT oder MRT –, sind letztlich Variationen zu Conrad Röntgens großem Thema: dem Blick in unser Inneres. Der bleibt uns ohne hochtechnische Hilfsmittel verwehrt so wie gegenwärtig schon der äußerliche Anblick unserer Zeitgenossen: Des Winters wegen stecken unsere Hände oft in Handschuhen, und vor Covid-19 schützen wir uns und andere mit einer Maske vorm Gesicht. ■
Nuschlt nisch so!
Dienstag, 19. Dezember „Barbara saß nah am Abhang / sprach gar sangbar, zaghaft langsam.“ Was ist das denn? Ein kindlicher Abzählvers? Ein Dada-Gedicht? Wer meint, die Zeilen ergäben keinen Sinn, irrt immerhin zum Teil: Sinn mag nicht in ihnen liegen; doch sie erfüllen einen guten Zweck. Ersonnen hat diese Sprechübung und viele andere, ebenso kuriose der Musikpädagoge Julius Hey. Vor etwa 120 Jahren brachte er in drei Bänden einen gründlichen „Deutschen Gesangsunterricht“ heraus; dann zog er noch die Konsequenz aus dem Umstand, dass zum Kunstgesang neben einer ausgebildeten Stimme in gleichem Maß eine manierliche Aussprache gehört. Bestätigt hatte ihn darin die Erfahrung mit etlichen seiner Schüler, die sich trotz stimmlicher Begabung singend nicht verständlich machen konnten: Sie artikulierten schlicht zu schlampig. Also fügte Hey seinem sehr erfolgreichen Großwerk einen „Sprachlichen Teil“ als Anhang an. Paradoxerweise überholte der das chef-d'œuvre, indem er als „Der kleine Hey“ bis heute Standards in der Sprecherziehung setzt. Ein fast humoristischer Titel, und warum auch nicht: „Mannhaft kam alsdann am Waldrand / Abraham a Sancta Clara.“ Darüber darf gelacht werden; Gesangs- und Schauspielausbildung sollte ja Spaß machen. Hingegen könnte einem das Lachen vor dem Fernseher, zum Beispiel beim „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“, vergehen: „Nuschelt nicht!“, möchte man als Besitzer eines guten Durchschnittsgehörs den Darstellerinnen und Darstellern zurufen, wenn sie ihre Wortwechsel als übereiltes Kauderwelsch nur so hinschludern. Schauspielkünstlerische Leichtgewichte wie Til Schweiger, einer der Unverständlichsten, lassen sich ignorieren; warum aber machts ein ausdrucksstarker Könner wie Wotan Wilke Möhring ohne Not genauso schlecht? Oder ein Charakterkerl wie Moritz Bleibtreu? Seine Mutter, die 2009 leider zu früh verstorbene Monica Bleibtreu, hatte das Sprechen noch zunftgemäß erlernt: Ihr lag geradezu auf der Zunge, wie man einen Satz angemessen anfängt, sinnvoll akzentuiert, interessant beschließt, wie Wortenden abfängt, Spannung aufbaut und hält, wie man die Tugend der Deutlichkeit pflegt, auch ohne künstelnd Silben und Laute zu exekutieren, und auch dann, wenn scheinbar nur von Beiläufigem die Rede geht. Stattdessen wird heutzutage von einigen Damen und weitaus mehr Herren genuschelt, gemauschelt und gebrummelt, bis von den Wörtern nur mehr zerkaute Reste bleiben. Befragungen ergaben, dass über zwei Drittel der Zuschauenden das Gerede aus dem Fernseher „häufig oder sogar sehr häufig“ schlecht verstehen. Darum zog der Westdeutsche Rundfunk inzwischen Experten des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen in Erlangen zurate. Zusammen mit ihnen experimentierte das WDR-Fernsehen während der vergangenen Wochen mit dem zusätzlichen Audiokanal „Klare Sprache“, der sich in empfangsfähigen Haushalten via Fernbedienung über das Tonmenü des TV-Geräts auswählen lässt. Eine andere Möglichkeit wäre, brabbelnden, schnoddernden und lallenden Akteuren und Aktricen körperliche Vorbilder zu empfehlen: etwa die „klar sprechenden“ Ensembles vergangener deutschsprachiger Kinoproduktionen oder ältere Semester aus diesen Tagen wie Monica Bleibtreus makellos formulierende Kollegin Senta Berger. Oder sie nehmen sich – coronabedingt haben sie ja Zeit – einfach mal wieder ihren „Kleinen Hey“ vor. ■
Beethoven? Beuys!
Dienstag, 15. Dezember Kunst machen ist schwer genug, Kunst organisieren, jetzt, in Seuchenzeiten, fast unmöglich. Dass das Beethovenjahr 2020 zum Flop missriet, hat ho-f vor wenigen Tagen ausführlich reflektiert. Nun hoffen wir zusammen mit Veranstaltern und Instituten darauf, dass im kommenden Jahr zumindest Grundzüge einer neuen Normalität einkehren. Ein Dürrenmattjahr könnten wir feiern, zu Ehren des Schweizer Autors zum hundertsten Geburtstag am 5. Januar; ein Baudelairejahr auch, weil der geheimnisvolle französische Dichter am 9. April vor zweihundert Jahren zur Welt kam. Unter den internationalen Schriftstellern empfehlen sich, gleichfalls 200. Geburtage halber, ferner Dostojewski (am 11. November) und Flaubert (am 12. Dezember). Wie wärs mit einem Magellanjahr (500. Todestag) oder, wenn mans für nötig hält, einem Napoleonjahr (200. Todestag am 5. Mai)? Wohlbegründet steht uns ein Sophie-Scholl-Jahr bevor (hundertster Geburtstag am 9. Mai) … Auch um den hundertsten Geburtstag von Joseph Beuys sollte die Kulturwelt sich kümmern. Und wirklich wird längst eifrig geplant, und zwar so, als wären wir alle unkaputtbar gesund, geimpft oder sonst wie gefeit. Wer wollte es den Kuratorinnen und Kuratoren verübeln, dass sie reihenweise mit den Hufen scharren? Immerhin handelt es sich bei Beuys um einen der prominentesten unserer Künstler aus dem zwanzigsten Jahrhundert und um einen der radikalsten. Kunst und Gesellschaft, Schöpfertum und Wissenschaft, Natur und Zivilisation dachte er auf sehr eigene und produktive Art zusammen. In Krefeld, wo er am 12. Mai 1921 zur Welt kam, bereiten sich die Kunstmuseen an mehreren Schauplätzen auf Präsentationen vor, deren erste – „Kunst = Mensch“ – am 28. März eröffnet werden soll. So viel Hoffnung tut uns gut, zumal im zweiten „harten“ lockdown, von wir nicht ahnen können, wie lang er währen wird. Begründeter ist sie vielleicht mit Blick auf eine weitere Schau, „Beuys & Duchamp, Künstler der Zukunft“, mit vorgesehenem Starttag erst am 8. Oktober. Bis dahin haben wir das Schlimmste vielleicht tatsächlich hinter uns. In greller Neon-Buntheit eines blühenden Optimismus öffnet sich die Website https://beuys2021.de/ vor den geblendeten Augen des Internetsurfers: Sie führt zusammen, was dem Land Nordrhein-Westfalen von Aachen über Düsseldorf bis Wuppertal zu „100 Jahren Joseph Beuys“ und zu seinen Lieblingsmaterialien Fett und Filz so alles einfällt. „was haben unser denken, unser fühlen und wollen mit plastik zu tun?“, erkundigt sich die Seite, psychedelisch die Farben wechselnd, in früher mal moderner Kleinschreibung. „ist kunst die einzige revolutionäre kraft? ist zukunft eine kategorie der kunst? sind das überhaupt die richtigen fragen?“ Und war, mag manch von uns hinzufügen, der vielberufene Visionär der Richtige, sie zu beantworten? Viele Kenner ließen und lassen sich mitreißen von seiner Vorstellung, dass „jeder Mensch ein Künstler“ und jeder Bereich des Daseins ein Ort der Kunst sei. Anderen waren fünf Kilo Butter an einer Wand schlichtweg zu wenig künstlerisch; sie nannten den Seher einen Scharlatan. ■
Stimmt das denn?
Samstag, 12. Dezember Schlag nach bei Shakespeare! Der englische Ausnahmepoet überliefert zum Beispiel, dass Iulius Caesar vor allem den Dicken vertraute: „Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, mit glatten Köpfen und die nachts gut schlafen.“ Aber stimmt das denn? Sprach der römische Imperator, an dessen realer Existenz die Historiker nicht zweifeln, den bewussten Satz vor gut zweitausend Jahren wirklich, und mit diesen Worten? Darauf kommts nicht an: Denn nicht als Promi der Weltgeschichte betritt er bei Shakespeare das Theater, sondern als literarische Figur, Geschöpf der Dichtung; und ihr ist so gut wie alles erlaubt. Gleichwohl reiben sich, seit es Dichtkunst gibt, die Geister an der Frage auf: Was ist Kunst, was Trugbild? Dem griechischen Denker Platon waren vor 2400 Jahren die Dichter nicht geheuer, machen sie doch, wie er meinte, als Geschichtenerfinder die Lüge zur Methode. Aus ähnlichen Gründen fühlt sich auch Oliver Dowden zurzeit nicht wohl: Anstoß nimmt der britische Kulturminister an der Erfolgsserie „The Crown“, weil Netflix die jüngere Geschichte des britischen Königshauses darin arg authentisch nacherzählt. Das freilich geschehe in einem „Drama“, hält der Streamingdienst dagegen und verweist auf sein dramaturgisches Recht, bei der Bearbeitung des Stoffs dies und das hinzuzufügen oder wegzulassen. Doch gerade deshalb fürchtet der Minister, „dass eine Generation von Zuschauern, die diese Ereignisse nicht erlebt hat, Fiktion mit Tatsachen verwechseln könnte“. Allerdings heißt so zu denken, die Illusionen der Kunst als arglistige Täuschung zu diskreditieren und dichterische Erfindung der heimtückischen Fälschung zu verdächtigen – das Fingierte mit dem Fiktiven zu verwechseln. Dabei stammen beide Fremdwörter vom selben lateinischen Verbum ab: Fingere heißt auf Deutsch etwas herausbilden, erdichten. Und wann übte Dichtung nicht die Tugend der Verdichtung, als zusammengefasster Inhalt in einer komprimierten Form? Sofern es dem Künstler darum zu tun ist, mit der Wirklichkeit nach- und neuschaffend umzugehen, ist Kunst etwas bewusst Gestaltetes: subjektive Schöpfung. Was die Dichter für Wahrheit halten, machen sie dem inneren Auge als Literatur, dem äußeren als Theater oder Film ersichtlich, als anschauliche Fantasie, auch schon mal als visionäre Unvorstellbarkeit. So kann Dichtung Erfahrungen aufzeichnen, Erlebnisse bewältigen, Überzeugungen untermauern, Unsagbares aussprechen. Folglich steht sie nicht der Lüge nah, sondern dem Spiel: Wie Kinder erproben die Künstler Möglichkeiten des Daseins; indem sie sich an Fiktionen versuchen, erforschen sie, was in Wirklichkeit die Wahrheit sein könnte. Jemand, der lügt, beschädigt den andern in seiner Würde. Die Künste hingegen – ob Bildnerei, Musik oder Dichtung – ergänzen das Gegenüber und bereichern es im günstigen Fall. Walter Kempowski stellte seinem Bestseller „Tadellöser & Wolf“ und den weiteren fünf Romanen über seine Familiengeschichte den Hinweis voran: „Alles frei erfunden“. Natürlich war es das ganz und gar nicht; sogar viele reale Namen behielt der Autor bei. Trotzdem entstand das Prosaepos als Konstrukt seiner Einbildungskraft. Auf deren Recht bestand vielleicht kein deutscher Dichter radikaler als Friedrich Schiller, als er 1801, in seinem Drama um Jeanne d’Arc, der spätmittelalterlichen „Jungfrau von Orleans“ statt des historischen Endes auf dem Scheiterhaufen den Schlachtentod einer gepanzerten Heroin zugedachte. Mit derart einschneidenden Manipulationen der Tatsachen, um nicht von Verdrehung zu reden, ist bei „The Crown“ nicht zu rechnen. Im Gegenteil: Den Royals missfällt die Serie, weil sie zu sehr ‚stimmt‘. ■
Findet das Rätsel!
Dienstag, 8. Dezember Das Alte Testament der Bibel berichtet von einem Rätsel der ungewöhnlichen Art: Denn nicht allein nach seiner Lösung gilt es zu suchen; das Rätsel selbst ist verschwunden. Die dazu passende Geschichte findet sich im Buch Daniel, dessen Titelheld, ein kluger hebräischer Edelmann, nach der Zerstörung Jerusalems im sechsten vorchristlichen Jahrhundert nach Babylon verschleppt worden ist und dort am Hof Nebukadnezars II. Dienst tut. Eines Tages träumt der König Wichtiges – nur entfällt ihm erwachend, was es war. Also trägt er den Weisen seines Landes auf, den Traum auszulegen und zuvor dessen Inhalt zu ermitteln. Keinem gelingt es, schon bangen die Gelehrten um ihr Leben – da gibt Gott seinem Getreuen Daniel die Antwort ein: Der Monarch schaute schlafend das Monument eines Menschen, fest gefügt aus Gold, Silber und Bronze, doch stand es auf Füßen aus Eisen und Ton; die zerschlägt ein heranrollender Stein, das Standbild stürzt, so wie alle bisherigen Weltreiche, die es symbolisiert, gestürzt sind – zermalmt vom auf ewig anbrechenden Reich des Gottes Israels. Gut 2500 Jahre nach der genialen Traumdeutung, vor wenigen Tagen erst, ging Tauchern, die in der Geltinger Buch an Deutschlands nordöstlichstem Ostseestrand nach verloren umhergeisternden Fischernetzen fahndeten, ein anderes, aber gleichfalls großes Mysterium ins Netz: eine Apparatur mit dem passenden Namen „Enigma“, nach dem altgriechischen Wort für Rätsel. Mit Hilfe des sagenumwobenen Wunderkastens verschlüsselte die nationalsozialistische Marine während des „totalen“ U-Boot-Kriegs ihre Funksprüche, die bei den alliierten Feinden lange für schlicht unknackbar galten. Schon 1918 hatte Arthur Scherbius das erste Modell ausgetüftelt. Während des Weltkriegs dann sollen 30 000, vielleicht sogar 200 000 Chiffriergeräte hergestellt worden sein; – gleichwohl haben sich nur ein paar wenige Exemplare des etwa zehn Kilogramm schweren „Rätsels“ erhalten. Verständlich darum die große Freude, als jetzt eines aus dem Ozean buchstäblich auftauchte. Den zerdrückten, zackenbewehrten Rostklumpen hielten die Finder zunächst für eine verrottete Schreibmaschine – in Wahrheit handelt es sich um einen Schatz: Vor fünf Jahren erstand ein Sammler in London ein Exemplar für 210 000 Euro. Ein Faszinosum ists eh: Um hinter die Geheimnisse des vertrackten Tasten- und Räderwerks zu kommen, richtete die britische Armee nördlich von London, in Bletchley Park, ein ausgewachsenes Forschungszentrum ein, das der geniale Alan Turing leitete. Als einer der großen Ideengeber des Computerzeitalters führte er es denn auch zum Erfolg, dank seiner „Turing-Bomben“, unablässig ratternder Riesenrechenautomaten im Format von etwa fünf mal zwei Metern. In Morten Tyldums viel gesehenem Film „The Imitation Game“ von 2014 spielt Benedict Cumberbatch das spröde Superhirn, das 1954, noch nicht 42-jährig, starb, wohl von eigener Hand. Wie unter den Maschinen kommen auch in der Musik harte Nüsse vor, die erst gefunden werden müssen, um geknackt zu werden: So behauptete Turings komponierender Landsmann Edward Elgar stets, er habe in seinen orchestralen „Enigma-Variationen“, denen er 1899 den Durchbruch verdankte, zusätzlich zum Hauptthema ein weiteres, okkultes Motiv versteckt und Mal um Mal verändert. Seither rätseln die Musikexperten. Für die Lösung (falls es eine gibt) bräuchte es wohl einen Turing der Töne. ■
Wissend sprechen
Samstag, 5. Dezember Nur wenn wir Wissen in jedem Fall für das glatte Gegenteil von Dummheit halten, ist Wissen in jedem Fall gut. Aber gibt es ‚schlechtes‘ Wissen? Mit überlegenem Feinsinn unterschied Elias Canetti das eine vom andern: „Gefährlich scheint mir das stumme Wissen, denn es wird immer stummer und schließlich geheim und muss sich dann dafür, dass es geheim ist, rächen. Das Wissen, das sich anderen mitteilt, ist das gute Wissen, wohl sucht es Beachtung, aber es wendet sich gegen niemanden. Man schreibt ihm die Eigenschaften des Lichtes zu, und man ehrt es, indem man es als Aufklärung bezeichnet.“ Was das sei, Aufklärung, hat uns Immanuel Kant beigebracht: nämlich der „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Von solcher Erleuchtung sollten sich so wenige Zeitgenossen wie möglich ausgenommen fühlen. Erst recht steht es uns nicht zu, jemanden für „unmündig“ – also für unreif und unwissend – zu halten, nur weil ihm wegen widriger Umstände in seinem Bildungsgang der Umgang mit Texten und also der Erwerb von von Wissen - von Informationen - schwerfällt. Die wenigsten, denen es so geht, „verschuldeten“ ihr Manko selbst. Für sie – und ebenso für jene, die Deutsch als Fremdsprache gebrauchen – setzte sich in den 2010er-Jahren die „Einfache Sprache“ durch. Ihren Vorgaben gemäß sendet zum Beispiel der Deutschlandfunk seit 2016 einmal pro Woche einen Nachrichtenüberblick: in kurzen Wortgefügen, ohne verschachtelte Nebensätze, ohne Fremdwörter, Metaphern, Sprichwörter, mit Erklärung schwieriger oder neuer Begriffe … Ausdrücklich ersetzen Eindeutigkeit und Schlichtheit den gepflegten Stil. Das soll ihn indes nicht abschaffen: Natürlich dürfen sie weiter an ihm hängen und ihn pflegen, die Dichter, Publizistinnen, Feuilletonisten und all die anderen sprachschöpferischen Arbeiterinnen und Arbeiter des Worts statt der Faust. Stil ist die Kalligrafie unseres Verstandes; viele von uns, der Schreiber dieser Zeilen eingeschlossen, haben nicht viel anderes gelernt. Aber wir müssen die Grenzen kennen, die wir uns nur zur Hälfte selber setzen. Die andere Hälfte diktieren uns die Leserinnen und Hörer unserer Texte. Denn die lehnen ein Wissen ab, das sich ausspricht, ohne sich einer möglichst großen Zahl unserer Nächsten mitteilen zu wollen. Das ist schlechtes Wissen, Herrschaftswissen, in das sich eine selbst ernannte Elite einschließt, um unter sich zu bleiben. Es ist sogar böses Wissen, weil es alle, die ‚nicht folgen können‘, vorsätzlich ausschließt, buchstäblich kaltlächelnd: gleichgültig und höhnisch. So mancher Expertenjargon – etwa der Juristen oder Mediziner, der Philosophen und anderer Geisteswissenschaftler – käme spielend mit der Hälfte der geschraubten Fachbegriffe aus und verlöre kaum an Gültigkeit, wenn er sich auch mal erzählend statt abstrakt äußern wollte. Freilich darf andererseits niemand verlangen, auf Wunsch von allem alles zu erfahren. Das Recht auf besondere Tiefe der Erkenntnis bleibt den Koryphäen, Forschern, Geistesgrößen unbenommen. Gerade ihnen aber schrieb Ludwig Wittgenstein (ein großer Denker, wenn auch keiner der leicht verständlichen) seinen berühmtesten Satz ins Stammbuch: „Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“
Im Tunnel
Dienstag, 1. Dezember „Niemand ist eine Insel“, no man is an island: So meditierte an der Wende des sechzehnten zum siebzehnten Jahrhunderts der fromme Poet John Donne und meinte damit die Menschen, von denen jede und jeder „ein Teil des Kontinents“ ist, ein Stück vom Ganzen. Donnes britische Heimat, jenseits des Ärmelkanals, ist freilich eine Insel und durch den fatalen Brexit ohne Not auch politisch wieder eine. Zwar misst der 563 Kilometer lange Kanal dort, wo er die Küsten am weitesten voneinander trennt, in der Breite 248 Kilometer; nur 34 Kilometer aber sinds an seiner schmalsten Stelle zwischen Calais in Frankreich (wo er La Manche heißt) und Dover in Südengland (wo sie ihn schlicht Channel nennen). Zumindest die geografische Isolation Großbritanniens lässt sich, wenn schon nicht beseitigen, so doch überwinden; wenn schon nicht überbrücken, so doch untertunneln. Damit begannen im Dezember 1987 britische Arbeiter, ein Dreivierteljahr später folgten französische Kollegen. Während sieben Jahren beteiligten sich 15 000 Bauarbeiter an der Wühlerei in bis zu vierzig Metern unter der Wasserstraße, um einen Schienenweg zu legen. Am Dienstag vor dreißig Jahren, um 12.12 Uhr, fiel die letzte dünne Gesteinswand, die Frankreich und England noch trennte. Damit hatte ein Projekt ein Ziel erreicht, das keineswegs erst einem Gedankenspiel des zwanzigsten Jahrhunderts entsprang. Schon zweihundert Jahre zuvor hatten Ingenieure an Möglichkeiten für einen solchen Tiefbau getüftelt; 27 Pläne, so heißt es, hätten im Lauf der Zeit vorgelegen – jeder scheiterte an der britischen Seite: Dort wollte man eine Insel bleiben, in gründlichem Widerspruch zu John Donne ausdrücklich abgelöst vom Rest des Kontinents. Gott selbst habe wohlweislich eine Festung aus Sturm um Britannien errichtet, da sollten Menschen besser kein solches Loch graben, predigte Henry Palmerston, der zwischen 1855 und 1865 zwei Mal in London als Premierminister amtierte. In Deutschland spann Bernhard Kellermann vor über hundert Jahren ganz ähnliche Pläne ins Überdimensionale weiter. Nicht auf die Grabungsvorhaben der Vergangenheit bezog er sich, sondern vergrößerte sie in seinem Science-Fiction-Roman „Der Tunnel“ ins Überdimensionale. 1913 erschien das – noch heute lesenswerte – Buch, das seines schlagartigen Sensationserfolgs wegen als der erste Bestseller eines deutschsprachigen Autors im vergangenen Jahrhundert gelten darf. Kellermann, 1879 in Fürth geboren und 1951 bei Potsdam gestorben, berichtet darin, wie ein visionärer Stahlfabrikant den Bau einer subozeanischen Verbindung zwischen Spanien, also Europa, und den Vereinigten Staaten, also Amerika, durchsetzt. Weil er begeisterungsfähige Politiker, potente Geldgeber und dienstbare Medien um sich zu sammeln weiß, vermag er endlich ein 180 000 Mann starkes Arbeiterheer ans Werk zu schicken. Das Projekt gelingt – freilich erst nach gut einem Vierteljahrhundert, unter horrenden Blutopfern und von der fortschreitenden Schiffs- und Luftfahrttechnik irgendwann uneinholbar abgehängt. Fünftausend statt fünfzig Kilometer unter Wasser sind selbst für gegenwärtige Techniker und Methoden ein bisschen zu viel. Heutzutage bewältigt ein modernes Verkehrsflugzeug die 6200 Kilometer von Frankfurt nach New York am Himmel in weniger als neun Stunden. Die Eisenbahn im kellermannschen Tunnel braucht einen Tag und eine Nacht.
Zwei Revolutionen
Samstag, 28. November Wer darauf zurückschaut, wie Staaten unterm Siegel des Kommunismus wuchsen und vergingen, der staunt leicht über zweierlei: Zum einen mag man kaum glauben, dass starke Regungen mitmenschlicher Empathie zu den Ursprüngen jener sozialen Heilslehre gehören, die sich nur zu oft in unmenschlichen Totalitarismus verkehrte; zum andern befremdet der Umstand, dass ausgerechnet einer ihrer wichtigsten Begründer der Unterart des homo oeconomicus zugehörte, die sie erbittert bekämpfte: dem Fabrikherrn. Wie Öl und Feuer verhalten sich Kapitalismus und Kommunismus zueinander, propagiert doch Letzterer den Übergang der Produktionsmittel in den Gemeinbesitz der Staatsbürger, desgleichen eine zentrale Lenkung von Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu, so die Theorie, komme es unausweichlich, weil das Proletariat den Klassenkampf gegen die ausbeuterische Bourgeoisie für sich entscheiden werde. An jenen Grundsätzen hielt Friedrich Engels, der am Samstag vor zweihundert Jahren in Wuppertal-Barmen als Spross einer gutsituierten Fabrikantenfamilie zu Welt kam, auch fest, als er zum Prokuristen, sogar Teilhaber des elterlichen Wirtschaftsunternehmens aufstieg. Freilich schadete der großbürgerliche Wohlstand seiner Hellsicht nicht. Unvoreingenommen kritisch beobachtete er seine Gegenwart und entwarf besten Willens die Vision einer gerechteren Gesellschaft, mochte die auch nicht anders als gewaltsam zu haben sein. Als gelernter Kaufmann und studierter Philosoph publizierte er seit seinen frühen Zwanzigerjahren eifrig. Mit gerade mal 24 zeichnete er die „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ so plausibel auf, dass die Studie das Weiterdenken seines Freundes Karl Marx maßgeblich bestimmte. Während seiner Mitarbeit in einer Dependance des väterlichen Textilbetriebs im britischen Manchester ergründete Engels akribisch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. Sein spürbares Entsetzen über die heillose Verelendung breiter Massen dokumentierte er 1825 in einem Buch dieses Titels, das den Wirtschaftsbossen der aufkeimenden Industriellen Revolution vorwarf, sie bereicherten sich wider alle Vernunft auf Kosten von Millionen entrechteter, in erbärmlichsten Verhältnissen vegetierender, sich zu Tode schuftender Lohnarbeiter. Das mit tiefem Mitgefühl „konstatierte englische Elend“ missverstand er nicht als insularen Sonderfall, sondern erkannte es allseits, auch in seiner deutschen Heimat als Auswuchs der unersättlichen Profitgier, die unter der besitzenden Klasse grassierte. Gemeinsam mit Engels schuf Marx im „Vormärz“ des Revolutionsjahrs 1848 mit dem „Manifest der Kommunistischen Partei“ eine Art Geburtsurkunde der ins Werk zu setzenden Weltrevolution. Indes folgten die „Proletarier aller Länder“ dem Appell der Autoren, sich zu „vereinigen“, in weitaus geringerem Maß als von ihnen erhofft. Für letztlich gescheitert mag man die beiden heute halten. Wer allerdings nach dem globalen Wendejahr 1989 und dem Pyrrhussieg des Kapitalismus an das „Ende der Geschichte“ – nämlich den Untergang des Totalitarismus und den Triumph der liberalen Demokratie – glaubt, so wie der US-Politologe Francis Fukuyama es 1992 tat, der liegt kaum weniger daneben.
2 x 3 macht 4
Dienstag, 24. November „Wir machen uns die Welt, / widdewiddewie sie uns gefällt ...“ So könnte es aus den Kehlen der selbst ernannten „Querdenker“ tönen, wenn sie, zusammengeschweißt durch faktenvergessenen Realitätsverlust, ohne Mundschutz, aber mit Tuchfühlung zu Hunderten oder Tausenden durch die Straßen deutscher Städte ziehen. Gewiss kennen die meisten von ihnen das Lied aus den Filmen um die kesse Pippi Langstrumpf, die heute selbst allerdings wohl keine „Querdenkerin“ wäre. Denn als etwas ganz anderes lernt man sie kennen in ihren Abenteuern, deren erstes am Donnerstag vor 75 Jahren im schwedischen Verlag Rabén & Sjögren als Buch erschien, als Querkopf nämlich, was geradezu das Gegenteil zum Dumm-, Hohl- oder Holzkopf ist. Der lässt sich fremdbestimmen, nimmt in seinem Echoraum jedes X für ein U, wenns nur weit genug hergeholt und fabulös genug daherspintisiert wird, und weist alle Gegenargumente Andersmeinender zornrot zurück. Demgegenüber gebärdet sich der Eigensinn eines Querkopfs, ganz so wie Pippi, unverkrampft, neugierig, kreativ. Astrid Lindgren, die literarische Mutter des Satansbratens, schuf für sie aus Motiven des Märchens und der Wirklichkeit eine eigenen Welt, „widdewiddewie“ sie ihr gefällt. Dort ist nicht alles schwarz vor Verschwörungsängsten; um Pippi schillert es nur so vor lauter Wundern, Wunschbildern und kuriosen Konklusionen, so „kunterbunt“ wie ihre Villa. Trotzdem behält sie die Füße auf dem Boden und den Kopf frei. Ein homo sapiens ganz singulärer Art: durchaus ein Mensch (der wörtlichen Übersetzung gemäß) mit Verstand und Vernunft, gleichwohl Optimistin um jeden Preis; denn immer rechnet sie mit dem Besten, mag sie auch mit Zahlen weniger gut rechnen: „Zwei mal drei macht vier, / widdewiddewitt, / und drei macht neune“, singt sie ungeniert. Aber dass sie immerhin bis drei zählen kann, reicht, um eigenverantwortlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Insofern erweist sie, das Kind, sich auch jenen „quer“, nämlich verquer denkenden Erwachsenen überlegen, die kürzlich in Pulks und zumeist unbedeckten Gesichts durch die Berliner Karl-Marx-Allee zogen um gegen die „Einschränkungen der Versammlungsfreiheit“ zu protestieren; auf kein totalitäres „Ermächtigungsgesetz“, sondern auf den Versuch, die Corona-Folgen einzuschränken, geht die Einschränkung besagten Grundrechts zurück. Trotzdem tanzte vor den zweitausend Marschierern eine junge Frau mit anarchisch abstehenden Pippi-Zöpfen an der roten Perücke und Langstrumpf am Bein und dirigierte die zu skandierenden Parole „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“. Astrid Lindgren, die 2002 fast hundertjährig in Stockholm starb, hätte sich „wahrscheinlich im Grabe umgedreht“, zeterte mit vollem Recht der Tagesspiegel. Im Winter 1941, mit 34 Jahren, erfand sie die aufmüpfige Göre mit der kolossalen Körperkraft und dem pompösen Selbstbewusstsein, um ihrer Tochter Karin die Zeit zu vertreiben, die mit einer Lungenentzündung das Bett hütete. Die Bücher, die aus den mehr oder weniger improvisierten Geschichten hervorgingen, wurden mittlerweile in siebzig Sprachen weltweit siebzig Millionen Mal verkauft. Wer heuer, unterm Unstern der Pandemie statt unterm Stern von Bethlehem, als seriös informierter Verstandes- und Vernunftmensch ein isoliertes Weihnachten zu Hause akzeptiert, der kann dort an Heiligabend, statt mit irregeleiteten Querdenkern und Querschlägern, Kontakt mit Pippi Langstrumpf pflegen: Im Zweiten Deutschen Fernsehen hat sie sich für 11.55 Uhr angesagt, mittels Mattscheibe verlässlich auf gebotener Distanz, wenn auch ohne Mundschutz vor der großen Klappe.
Mai im November
Samstag, 21. November Wie in den meisten Fällen damals ging es um Religion. Und wie so oft, bis heute, kam schlechtes Wetter guten Absichten in die Quere. Im England des siebzehnten Jahrhunderts wollte weder der König noch die Kirche die Puritaner auf der Insel dulden; hielten die sich doch für „Heilige“ und „Reine“, jedenfalls für reiner als die Anhänger der staatlich anerkannten, weil von oben verordneten anglikanischen Reformkirche, die sie von katholischen Altlasten ausgehöhlt glaubten. Als fundamentalistische Calvinisten waren sie überzeugt von der Prädestination, unterwarfen sich ausschließlich den Geboten der Bibel, verabscheuten klerikalen Prunk und persönlichen Protz und hielten auf strengste Sittlichkeit. Etliche von ihnen, dazu Handelsleute und abenteuernde Glücksritter, insgesamt 102 Passagiere, stachen am 16. September 1620, weit später als ursprünglich geplant, an Bord eines etwa dreißig Meter langen Seglers von Plymouth aus in See, um nicht zurückzukehren. Auf der von gut dreißig Besatzungsmitgliedern gesteuerten Mayflower – der „Blume im Mai“ – langten die „Pilgerväter“ mit Frauen und Kindern nach 66 unruhigen Tagen, fünf Todesfällen, zwei Kindsgeburten und reichlich erlittener Seekrankheit an der Ostküste Nordamerikas an; allerdings nicht dort, wohin sie sich wünschten. Als Ziel hatten sie Virginia ins Auge gefasst, seit 1607 die erste dauerhaft bewohnte Siedlung Englands in der „Neuen Welt“, wo sie sich am florierenden Tabakanbau zu beteiligen hofften. Doch widriger Wetterbedingungen wegen mussten sie umsteuern: Weiter nördlich, bei Cape Cod (auf Deutsch: Kap Kabeljau) gingen sie am Samstag vor vierhundert Jahren an Land, dort, wo später der US-Staat Massachusetts entstehen sollte. Beim heutigen Provincetown wollten sie zumindest den Winter abwarten; einen Monat später siedelten sie, der besseren Aussichten auf gedeihliche Landwirtschaft wegen, in die Kolonie über, die wie der englische Startpunkt ihrer Reise Plymouth hieß. Zehn Tage bevor sie von Bord gegangen waren, hatten sie, um Streitereien zu schlichten, untereinander einen Vertrag ausgehandelt: Im Mayflower Compact treten sie zwar als weiterhin „treue Untertanen“ ihres „gefürchteten souveränen Herrn, König James“ in London, auf; zugleich aber manifestiert sich in dem Dokument erstmals auf amerikanischem Boden der Wille einer Aussiedlergemeinschaft, sich als „zivile Körperschaft“ selbst zu verwalten, sich dafür gerechte und für alle gleiche Gesetze zu geben und als Einzelner Entscheidungen der Gemeinde auch dann anzuerkennen, wenn sie der eigenen Meinung zuwiderlaufen. Verfassungskundlern gilt die Übereinkunft als früher Bau-, wenn nicht als ein Grund- und Eckstein für die gut 150 Jahre später ausgefertigte „einstimmige Erklärung der [ersten] dreizehn Vereinigten Staaten“, ihre Souveränität betreffend. Auf die Puritaner von damals reichen die Stammbäume vieler Familien der wohlhabenden amerikanischen Oberschicht zurück. Bis heute feiern US-Bürger aller Bekenntnisse mit dem gebratenen Truthahn zu Thanksgiving – immer am vierten Donnerstag im November und heuer am 26. – das erste Erntedankfest der pilgrim fathers nach. Weit kürzer überdauerte der originale Dreimaster ihrer Überfahrt. Bereits 1624 nannte ihn ein Gutachten einen „Trümmerhaufen“. Doch existiert von der legendären Galeone ein Nachbau, der 1955 und 1956 originalgetreu auf einer englischen Werft entstand. Um jetzt für das Jubiläum fit zu sein, musste sich jene Mayflower II einer Rundumreparatur unterziehen: Auch an ihrem noch nicht siebzigjährigen Holz hatte schon der Zahn der Zeit in Gestalt gefräßiger Käfer genagt. ■
Barfuß nach China
Dienstag, 17. November Bayreuth, Festspielhaus, letzter Schultag vor den Sommerferien 2010, Tag der Zeugnisvergabe. Auf der Bühne, von Musik umtost, saust und springt der Pumuckl durch eine Klassenzimmer-Szenerie und darf auf gute Noten nicht hoffen. Dem Herrn Mime, seinem verzweifelnden Lehrer, macht der umtriebige Rabauke mit dem roten Wichtel-Wuschelkopf das Leben zur Hölle: Er will partout nicht lernen und schmeißt obendrein noch das Inventar durcheinander. Zum guten Schluss erreicht er das Klassenziel trotzdem: In Richard Wagners musikdramatischem „Ring“-Vierteiler heißt der Pumuckl Siegfried, bezwingt einen Bären, tötet einen Drachen, gewinnt eine Frau und wird in ihren fülligen Armen zum Mann. Dass der Sänger Lance Ryan in Hans Castorfs Inszenierung aussah wie der rotzfreche und wieselflinke Zwerg aus der populären TV-Serie und der Fantasiewerkstatt der vielseitigen Ellis Kaut, gehörte zu den Gags der insgesamt unorthodoxen Werkdeutung. Mit 94 Jahren starb die Autorin im September vor fünf Jahren; da war aus ihrem Pumuckl längst eine profitable Marke geworden. Am Dienstag vor hundert Jahren kam Kaut in Stuttgart zur Welt. Schauspielerin wollte sie erst werden und studierte dann Bildhauerei. Berühmt- und Beliebtheit aber erlangte sie schreibend, was sie früh auch für Kinder tat. 1962 erfand sie den komischen Kobold, mit dessen Namen ihr eigener stets in einem Atemzug genannt wird. Als Hörspiel-Hauptfigur trat der Pumuckl aus den Studios des Bayerischen Rundfunks (für den Ellis Kaut auch Schulfunk-Beiträge verfasste) in die Kinderzimmer des Freistaats und der Republik. Inzwischen hat er sich, ob in Büchern oder Hörbüchern, Fernseh-, Kinofilmen oder Musicals, durchs In- und Ausland bis nach China gekaspert, wohlgemerkt barfuß. Allein ist er dabei nicht: Seit er nicht mehr als Klabautermann zur See fährt, haust er beim Münchner Schreinermeister Eder, der unfreiwillig das Privileg besitzt, das liebenswürdig quecksilbrige, aber nicht ganz harmlose Wesen aus der Zwischenwelt als Einziger sehen zu können. Wo gehobelt wird, da fallen Späne: Spannungen bleiben nicht aus – eine Zwangsgemeinschaft, könnt man irrig annehmen. Eine Symbiose ists in Wahrheit. Die beiden mögen sich, so oft sie einander auch mit Lärm oder List oder aus Liebe auf die Nerven gehen. Auf der Felsenbühne der Wunsiedler Luisenburg verwandelte 2011 der wunderbar unaufhaltsame Ferdinand Schmidt-Modrow – artgerecht unter feuerroter Struwwelperücke, mit gelbem Hemd, grünen Hosen und übergroßen Füßen – den Klabautermann in einen durchtrainierten Kletterkünstler. Am Rand der Premiere berichtete eine Lehrerin damals, die Kinder aus den ersten und zweiten Klassen ihrer Grundschule hätten zuvor mit den prominenten Namen aus Ellis Kauts Geschichten nichts anfangen können. Kaum mag mans glauben, verschwand der Feuerkopf doch nie aus den Buchhandlungen oder vom Bildschirm. Dorthin soll er nun zurück (ob via Fernsehen oder Streaming-Dienst, steht noch dahin): 2022 wird eine neue Serie ausgestrahlt, dreizehn Folgen gehen im kommenden Jahr in Produktion – und das ist nur die erste Staffel. ■
Kalte Fälle
Samstag, 14. November Opfer tot, Akte zu? So leicht machen es sich die Sicherheitsbehörden hierzulande nicht. Hinter den Schuldigen an Mord und Totschlag sind sie mit akribischer Sorgfalt her und mit einer Geduld, die nicht selten Jahre durchhält. Selbst Spuren von mikroskopischer Größe, Bruchstücke von Erbmaterial, Fragmente von Finger-, Fuß- und Zahnabdrücken, Miniquäntchen von Giften und verdächtigen Substanzen entgehen ihnen nicht. Nur fünf Prozent der – als solche erkannten – Tötungsdelikten in Deutschland bleiben trotz ehrgeizigster Anstrengungen und zeitgemäßer Hilfsmittel unaufgeklärt. Das ist nicht viel, doch es reicht: Als Cold cases, „kalte Fälle“, nehmen sich – wie die Fans einschlägiger Serien im Fernsehen und bei Streaming-Diensten sehr gut wissen – spezielle Ermittler immer wieder ihrer an, mit Verfahrensweisen, die es, als die Tat vor vielleicht zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren geschah, nicht gab. Nicht selten indes liegen spannende Freveltaten viel weiter zurück. Um sie kümmert sich eine kriminologische Spielart der Archäologie: Ihre geschichts- und altertumskundigen Experten treffen sich auf halbem Weg mit Vertretern und Vorgehensweisen der modernen Verbrechensforschung. Ein Loch im Schädel, heute entdeckt, sieht wie ein Loch im Schädel aus, ganz gleich, ob es vor fünfhundert, zwei- oder zwanzigtausend Jahren eine Keule oder vor zwei Tagen das Projektil einer Pistole schlug. Letztlich geht es den Spezialisten beider Fakultäten stets und gleichermaßen um eine Rekonstruktion, wie es gewesen sein könnte: um das aus Fakten und Schlussfolgerungen komponierte Bild eines Geschehens, hinter dem immer auch menschliche Geschichten stehen und das, bei ausreichender Tragweite und hinlänglicher Prominenz der Beteiligten, zu einem Stück Geschichte wurde. Zu den berühmtesten Mordopfern aller Zeiten gehört Julius Cäsar, als Täter stehen Cassius, Brutus und ihre Mitverschwörer fest. Wer aber hat, während der so exzentrische wie skrupellose Nero das kaiserliche Rom regierte, den großen Brand der imperialen Metropole entfacht? (Nero jedenfalls wars nicht.) Oder „wer hat Ötzi umgebracht?“, fragt das ZDF, das am Sonntag von viertel neun bis Mitternacht, in fünf Doku-Serienfolgen am Stück, den „Tatort Antike“ betritt. Zeitlich reicht das dabei aufgeschlagene Straftatregister bis in die Steinzeit zurück, wo es einen Neandertaler erfasst, der nach der nordirakischen Fundstätte seiner Höhle „Shanidar 3“ heißt: Unzweifelhaft starb der Hominide gewaltsam an den Folgen eines Stichs in seine Brust – „womöglich der älteste bekannte Mordfall der Geschichte“, munkelt der Sender in einer Ankündigung. Zur Spurensuche versammeln sich Angehörige von lauter Berufen, an die weder zu „Shanidars“ noch zu Neros Zeiten schon zu denken war: forensische Biologen und Biochemiker, Profiler, psychiatrische Sachverständige, Tier- und Pflanzenforscher im Dienst der Rechtspflege ... Ihre Ergebnisse können belegen, dass die Menschen aus vermeintlich endlos ferner Vergangenheit vielfach aus ganz ähnlichen Antrieben agierten, reagierten, überreagierten wie die Zeitgenossen der Gegenwart. Zu sehen ist auch, wie eine weitere Spielart der Altertumskunde sich bewährt, die experimentelle Archäologie: Ihre Adepten bauen uralte Fahrzeuge, Gebrauchsgegenstände, sogar ganze Burgen mit den Mitteln von damals nach. Waffen auch: Was damals schon beim Töten half, taugt heute noch dazu. ■
Fremde Zungen
Dienstag, 10. November Wir Menschen sind lernende Wesen, von Geburt an und vielleicht schon davor. Unter den mancherlei possierlichen Mythen rund um die Unschuld der Kindheit ist auch jener ein Unsinn, dass der Säugling die Muttersprache mit der Muttermilch einsauge. Neu, im denkbar umfassendsten Sinn, war für uns als Neugeborene alles, dem wir im Licht der Welt, kaum dass wirs erblickten, begegnet sind, sogar das Gesicht unserer Mama, nicht ihre Stimme, wohl aber ihre Sprache. Fremdsprache war sie und wollte in zähem Ringen, zusätzlich zu allem andern, gelernt werden. Trotzdem sprechen über vierzig Prozent von uns neben der Sprache des Landes eine weitere mehr oder weniger fließend, dreizehn Prozent sogar zwei, drei Prozent drei. Die Polyglotten – wörtlich übersetzt, die „Vielzüngigen“ – sind gar mit fünf oder mehr Sprachen wohlvertraut, machen indes kaum ein Prozent von uns aus. Übertrumpft sehen wir alle uns von dem italienischen Kardinal Giuseppe Mezzofanti: 1774 in Bologna in einfachsten Verhältnissen geboren, soll er schon mit fünfzehn ein ausstudierter Philosoph gewesen und später, durch geradezu süchtiges Bemühen, in Schrift und Rede von sage und schreibe 38 Sprachen sattelfest geworden sein; mit noch dreißig weiteren ging er außerdem um, wenn auch weniger virtuos. Wie hätte das klerikale Superhirn auf die vierzig Prozent von uns Zeitgenossen geblickt, die nicht einmal in einer einzigen fremden Zunge zu parlieren verstehen? Für jene, denen es nicht völlig an Grundkenntnissen und schon gar nicht an gutem Willen gebricht, gibt es – neben tauglichen Online-Übersetzern – das gute alte fremdsprachliche Wörterbuch, das dort aushilft, wo der passende Begriff fehlt. Am Mittwoch vor 125 Jahren starb mit Gustav Langenscheidt ein Pionier dieses besonderen lexikalischen Genres. Allerdings setzte er seinen pädagogischen Ehrgeiz – zusammen mit Charles Toussaint – zunächst in einem praktikablen System für französischen Sprachunterricht in Briefform, zum Selbststudium, um; nicht zuletzt eine Lautschrift erfand er dafür. 1856 gründete der gelernte Kaufmann einen Verlag, zwölf Jahre später seine eigene Druckerei. Heute hat das renommierte Haus Wörterbücher, Bildwörterbücher, Sprachkurse und -führer für fast vierzig europäische, amerikanische, afrikanische und asiatische Idiome im Sortiment. Übrigens war Langenscheidt selbst durchaus kein Genie: Als sich der achtzehnjährige Gustav 1850 auf große Wanderschaft durch die deutschsprachigen Lande, Frankreich, England, Belgien und Italien begab, radebrechte er gerade mal ein bisschen Französisch. Mithin blieb ihm, wie er schrieb, das „peinliche Gefühl“ nicht fremd, „unter Mensch nicht Mensch sein und seine Gedanken austauschen zu können“. Ganz in seinem Sinn will der Langenscheidt-Verlag – wie es auf seiner Website heißt – „Vermittler zwischen Menschen und Kulturen“ sein; das dürfen alle Unternehmen seiner Art für sich in Anspruch nehmen. An das Sprachwunder Mezzofanti, das eine ganze Welt aus Wörtern in sich trug, reicht zwar kein normaler Sterblicher heran. Doch schon ein paar Brocken einer fremden Sprache, erst recht Wörterbücher verlocken uns dazu, wenigstens auf kleinen Strecken hinter dem Horizont der heimischen Vokabeln unterwegs zu sein. ■
Wir sind gewarnt
Samstag, 7. November Nichts reizt unsere Neugier stärker als das Abträgliche. Jetzt dürfen sich auch die Nutzer des Streaming-Portals Netflix darüber freuen, dass ihnen empfohlen wird, unter Umständen nicht so genau hinzuschauen, denn jetzt werden sies erst recht wissen wollen. Stellen wir uns vor: ein x-beliebiger Abend; wir hatten reichlich zu tun; schon lockt leise das Bett. Erst aber sehnen Körper und Kopf sich nach leicht verdaulicher Kost. Unserem Kopf kann das Fernsehen sie spenden. Auswahl besteht durchaus: Kochshows, Krimis wahlweise aus britischen, schwedischen, dänischen Serien oder „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Folgen, von denen meist zwei oder drei gleichzeitig laufen, ferner Frauentausch, gesuchte und gefundene Superstars, Liebeslustanbahnungen, Genuscheltes aus dem „Big Brother“-Bunker, Chaos in der Messie-Wohnung, Dokumentationen über Hitlerhimmlergoebbels … Besser nichts davon? Dann vielleicht eine gehörige Portion krachender Action aus dem Unterhaltungskino. Spätestens nach 22 Uhr müssen vor einschlägigen Genrestreifen die Sender auf eventuell „entwicklungsbeeinträchtigende Programminhalte“ hinweisen, so wie das der Staatsvertrag zum „Jugendmedienschutz“ löblich verlangt: Die folgende Sendung, teilen uns Schrifttafeln und freundliche Stimmen dann mit, sei „für Zuschauer unter sechzehn Jahren nicht geeignet“. Na hoffentlich, denken wir zufrieden. Haben wir uns etwa auf die Kinderstunde eingelassen? Wir erwarten, dass es einigermaßen zur Sache geht, Adrenalinreste in unserem Blut noch einmal aufschäumen und ein paar niedere Instinkte angesprochen werden. Und wir erinnern uns: Kam uns als Kindern und Halbwüchsigen nicht oft genug die gespannte Lust auf TV-Spätprogramme für Erwachsene an? Als wir dann selber Töchter oder Söhne und die ihre eigenen Fernseher hatten – kontrollierten wir da regelmäßig, welchem harten Stoff sie sich womöglich dann und wann gierig hingaben? Hätten wir ihnen davon abgeraten, sie hätten lächelnd abgewinkt. Selten hindern uns Warnungen daran, etwas mitzubekommen, das nicht für uns bestimmt ist. Nun also leitet Netflix drei Folgen aus der vierten Staffel seiner Serie „The Crown“ – über die Regierungszeit von Englands ewiger Königin Elizabeth II. – mit einer alarmierenden Mahnung ein: Szenen rund um die an bulimischer Magersucht erkrankte Herzens-Prinzessin Diana seien so ungeschönt inszeniert, dass sie empfindliche Gemüter verstören könnten. Solch ein Tipp scheint berechtigt, nur hätte er weit früher kommen sollen und an anderen Orten: überall dort, wo meschuggene Modemacher, schwachsinnige Schönheits-Gurus und ignorante Influencerinnen jenes absurde Frauenbild propagieren, das Figuren über Kleidergröße 36 bereits als curvy, kurvig, denunziert: als zu dick. Ein Vorwurf, der gerade für unfertige Menschen „unter sechzehn Jahren nicht geeignet“ ist. Auch an Ana Carolina Reston oder Luisel und Eliana Ramos erinnern wir uns dunkel, an ausgezehrte Models, die vor zehn und dreizehn Jahren buchstäblich Hungers starben, was die Welt der Couture und des Konsums allerdings nur kurz aufschreckte. Wo auch immer Mädchen und junge Frauen abschüssige Wege in die Dürre einschlagen, müssen wir als Eltern und Gesellschaft ihnen begreiflich machen, dass kein Karriereprogramm „entwicklungsbeeinträchtigender“ wirkt als der Entschluss, die Nahrungsaufnahme einzustellen. ■
Sissi ohne Süße
Dienstag, 3. November Sie war schön. Ihr Leben wars nicht. Dass neben ihr auch anderen Frauen Attraktivität, Charisma und Eleganz gegeben waren, ließ Elisabeth, Kaiserin von Österreich, uneitel gelten. „Ich lege mir ein Schönheiten-Album an und sammle nun Fotografien, nur weibliche“, ließ sie 1862 von Venedig aus Ludwig Viktor, den jüngsten Bruder des Kaisers, wissen, den sie deshalb bat, in Foto-Ateliers nach „hübschen Gesichtern“ zu fahnden und ihr die Lichtbilder zuzuschicken; ähnliche Bittbriefe gingen nach Berlin, Paris und London, St. Petersburg und Konstantinopel. Die drei kostbar ausgestatteten Sammelbände mit abgelichteten Beautés gehören zu einem Konvolut von insgesamt achtzehn Alben, in denen Elisabeth Fotos aus ihrem Privatbesitz zusammentrug. Das Museum Ludwig in Köln verwahrt sie – und zeigte sie jetzt eine Woche lang öffentlich in einer Schau, die am Montag, der neuerlichen Anti-Corona-Maßnahmen wegen, gleich wieder schließen musste. Bis zum 24. Februar ist die Ausstellung anberaumt; vielleicht endet der Lockdown ja so rechtzeitig, dass noch Zeit für Besuche bleibt. Denn mit einer einzigartigen Kollektion bekommt man es offenbar zu tun: mit nicht weniger als zweitausend Abzügen im Format neun mal sechs Zentimeter, die bedeutende Werke der Kunst festhalten, vor allem aber Porträts hochwohlgeborener Verwandter und von Berühmtheiten der Zeit. An ihnen – „kreativen Collagen, Ideenräumen für soziale Gefüge, Medien der Selbstreflexion“ – habe die Kaiserin ihre eigene Selbstinszenierung orientiert, teilt das Museum mit. Über sich reflektiert hat Elisabeth ihr zunehmend eigenwillig-selbstbewusstes Leben lang: Vor allem mit der eigenen Person und Rolle war sie beschäftigt. Denn was einigermaßen als Liebesbund begonnen hatte, die Ehe der Sechzehnjährigen mit dem Cousin und Regenten Franz Joseph, ging bald durch Distanz und Depression verloren. Als noch fast kindliche Braut aus Bayern am Wiener Hof eisig empfangen, entfloh sie immer öfter, immer konsequenter, psychisch und physisch: in die Magersucht, rastlos auf endlosen Reisewegen und zu Aufenthalten in der Ferne. Indem sie Sympathien für die Unabhängigkeitsbewegung in Ungarn hegte, entfremdete sie sich dem Gatten erst recht. Unter dem Freitod ihres tragischen Sohnes, des Kronprinzen Rudolf, 1889 in Meyerling brach sie fast zusammen (wie Franz Joseph auch). Nachdem der Sechzigjährigen 1898 am Genfer See der Italiener Luigi Lucheni eine Feile in die dürftige Brust gestoßen hatte, nahm der Kaiser die Botschaft ihres Todes resigniert entgegen: „Mir bleibt auch nichts erspart.“ Von all dem berichten die drei „Sissi“-Filme nichts, in denen Ernst Marischka als Regisseur und Autor 1955 bis 1957 die wahre Biografie operettensüß als herzige Liebesgeschichte vergoldete und die historische Gestalt zur Leinwandlegende verklärte. Romy Schneider hat sie gespielt: Auch sie war schön; auch ihr Leben wars am Ende nicht; auch sie musste den Tod eines Sohnes beklagen. 1982 starb sie in Paris, nur 43 Jahre alt, an Herzversagen, als wärs am selben Überdruss, der die Kaiserin mehr als ein halbes Leben lang begleitet hatte. Auf zahllosen Fotos blieb und bleibt die Schauspielerin nach ihrem Tod lebendig. Indes finden sich unter den zweitausend Lichtbildern in Elisabeths Alben gerade mal fünf von ihr selbst. ■
Leben schauen
Samstag, 31.Oktober Was davon bis heute übrigblieb, hat eine Vorführdauer von gerade mal sechs, höchstens sechzehn Sekunden: neun Kürzestfilmchen aus einer Zeit, als es das Kino noch nicht gab. Produziert hatte sie federführend Max Skladanowsky zusammen mit seinem Bruder Emil: Szenen aus der artistisch-tänzerischen Varieté-Halbwelt Berlins, durch eine Kamera mit Handkurbel eingefangen auf sechs Meter langen Streifen mit jeweils maximal 192 Einzelaufnahmen. Mühsam schnippelten die Brüder die Fotos auseinander, um sie, immer abwechselnd, zu zwei neuen Streifen zusammenzukleben. Indem sie schließlich mittels zweier Projektoren eine Leinwand bestrahlten, ergab sich ein weitgehend flimmerfreies Gesamtbild: Knappe Szenen wiederholten sich in Dauerschleife, aber wohlgemerkt bewegt. Das war neu, eine Revolution sogar. Bei der ersten öffentlichen Vorführung, am Sonntag vor 125 Jahren im Berliner Unterhaltungs-Etablissement „Wintergarten“, schlug eine der Geburtsstunden des Kinos. „Bioskop“ nannten die Skladanowskys ihre Erfindung, die es der griechisch-lateinischen Wortbedeutung zufolge erlaubte, künstliches „Leben zu schauen“. Zu sehen war beispielsweise eine Kinderschar beim „Italienischen Bauerntanz“, der Ringkampf zweier Athleten und ein Mr Delaware beim Boxkampf mit einem Känguru. Zum Schluss verbeugten sich die Brüder vor den Zuschauern, natürlich wiederum von der Leinwand herab. Zum ersten Mal hatten Bilder laufen gelernt: Nach der fünfzehnminütigen Uraufführung der „beweglichen Bilder in Lebensgröße“ wandte sich der 32-jährige Max siegestrunken leibhaftig an „mein über alles geliebtes Publikum“: „Ich frage Sie: Haben Sie eine Weltsensation bekommen?“ Oh ja, meinten die 1500 zahlenden Gäste, durchaus: Sie staunten und jubelten. Das Selbstbewusstsein blieb dem Pionier jahrzehntelang erhalten, auch als die Geschichte des Kinos längst an ihm vorbei, wenn nicht über ihn hinweggerast war. Nur sechzehn Monate später, am 31. März 1897 in Stettin, versammelte er letztmalig ein „geliebtes Publikum“ um sich und seine Maschinen; immerhin aber hatte er unbestreitbar den Wettlauf um die erste Darbietung „Lebender Bilder“ aus Licht gewonnen. Als er nur wenige Wochen nach diesem Triumph in Paris überrundet wurde, war er selbst anwesend: Am 28. Dezember 1895 verfolgte er im „Grand Café“ der französischen Hauptstadt die erste Präsentation des Kinematografen, mit dem die Brüder Louis Jean und Auguste Lumière einem zahlenden Publikum elf Filme vorführten, jeder etwa eine Minute lang. 33 Francs flossen dafür in ihre Kasse; kurze Zeit später, als sie ihr Programm täglich zwanzig Mal zeigten, hatte sich die Tageseinnahme auf stolze 2500 Franc erhöht. Übrigens griffen die Lumières schon gleich in dieser allerersten Phase von der Wirklichkeit aus ins Fantastische über, experimentierten also mit Möglichkeiten, wie sie seither kein anderes Medium so unerschöpflich bietet wie die bewegte Lichtbildnerei: Erst zeigten die Filmemacher eine Steinwand beim Einsturz, dann dieselbe Bildfolge rückwärts – der Eindruck entstand, als baute sich die Mauer von selbst wieder auf. Trotzdem: „Was Wagner für die Musik war, bin ich für den Film“, schrieb Max Skladanowsky noch 1934, fast vierzig Jahre nach seinem Glückstag (und fünf Jahre vor seinem Tod), auf eine Postkarte, die er aus der Festspielstadt Bayreuth verschickte. Da freilich hatte sich das anfängliche Schausteller-Spektakel längst zur Filmkunst, das Demimonde-Varieté zum glitzernden Kinopalast, die Beine schmeißende Aktrice oder der Fäuste schwingende Kraftmeier zum Star ausgewachsen – ganz ohne Skladanowskys Zutun. Ein Stern auf dem Berliner „Boulevard der Stars“ ehrt ihn dennoch, sehr zu Recht. ■
Kurios im Kopf
Donnerstag, 29. Oktober Dem Schreiber dieser Zeilen hat sein Vater, ein gescheiter Mann, nicht viel über seine Kriegszeit beim Militär erzählt, ein paar Mal aber die folgende Anekdote. Ein Ausbilder aus der Berliner Gegend, als scharfer Schinder gefürchtet, habe ihm, dem Rekruten, die Frage ins Gesicht geschrien: „Wat, telljent wolln Se sein? Intelljent sin Se!“ Auch zu aktuellen Ereignissen mitten im Coronozän scheint jene paradoxe Wortverdrehung zu passen. Zum Beispiel auf die „Fetischparty“, zu der sich vor fünf Tagen sechshundert Feiernde in Berlin-Mitte auf viel zu engem Raum zusammenfanden; im Tagesspiegel zog die Polizei später in ungerührtem Sicherheitskraftdeutsch Bilanz: „Erkennbar ist, dass die Akzeptanz zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sichtbar abnimmt.“ Oder tags darauf, jenseits des Atlantiks – da gab US-Präsident Donald Trump bekannt, wie sich die Masse der Pandemie-Opfer in seinem Land schnell und stark verkleinern ließe: „Wenn wir halb so viel testen würden, wäre ihre Zahl halb so hoch.“ Derlei Verhaltensweisen und Verlautbarungen können wohl nicht einmal mehr Restmengen von „Telljenz“ entsprungen sein. Weit eher handelt es sich um Manifestationen jener „Intelljenz“, die der weiland Wehrmachtsschleifer monierte. Zugegeben, der Gesundheit des „gesunden Menschenverstands“ war noch nie so recht zu trauen, und erst recht seit Ausbruch der Seuche wähnen sich Überängstliche immer bedrängender von kurios verqueren Köpfen umzingelt. Das mag auf Einbildung beruhen; doch regt all das bewusstseinstrübe Treiben und Getwittere dazu an, grundsätzlich darüber nachzudenken, was Intelligenz eigentlich sei und wo man sie findet. Umschreiben lässt sie sich als die Gabe, Verstand und Vernunft, Erfahrung und Empathie, Kenntnisse und Kreativität ausgewogen dafür einzusetzen, Veränderungen zu verstehen und planvoll-zweckgemäß auf sie zu reagieren. Die meisten Alltagsleute und Durchschnittsbürger verfügen über mehr oder weniger davon. Stets aber haben im Lauf der Geschichte die Menschen die Ignoranz ihrer je eigenen Epoche für die schlimmste seit Adam und Eva gehalten. Freilich darf auch das gegenwärtige Zeitalter, trotz Digitalisierung a tempo, Nanotechnik und Marsmissionen, nicht uneingeschränkt beanspruchen, für erleuchtet zu gelten. Zwar wollen US-amerikanische Forscher ermittelt haben, dass sich der Intelligenzquotient der Menschen seit hundert Jahren von einer Generation zur nächsten stetig erhöhe; allerdings erhöht sich die Glaubwürdigkeit dieser Behauptung nicht in gleichem Maß, wenn man die zurzeit sprunghafte Vermehrung von Flat-Earth- und Chemtrail-Freaks beobachtet, von QAnon- und Deep-State-Glaubensgemeinschaften, von Aluhüten, Jüdische-Weltverschwörungs-Rassisten und weiteren keineswegs nur harmlosen Spinnern. Mit mehr als einer dieser Gruppen sympathisiert der Staatschef der Vereinigten Staaten übrigens unverhohlen. Wenn in vier, sechs oder acht Monaten Impfstoffe gegen Covid-19 hoffentlich gefunden sein und in der Breite eingesetzt werden, wäre die Zeit gekommen, mit einem ähnlichen Aufwand an „Telljenz“ respektive Intelligenz nach einem zerebralen Immunserum zu forschen, dass die vielen im Ausnahmezustand ex- oder implodierenden Gehirne einigermaßen kuriert. Indes sind solche unerfüllbar frommen Wünsche nicht weniger uralt als die Klagen über das Grassieren der Unwissenheit. Schon vor fast neunzig Jahren ließ der Komödienschreiber Curt Goetz einen Arzt auf offener Bühne resignieren: „Die Mikrobe der menschlichen Dummheit ist unausrottbar.“ ■
Kaputt, geklaut
Dienstag, 27. Oktober Kriminalität und Kunst kommen vor allem bei drei Gelegenheiten zusammen. Zum einen durch Fälscher: Fachleuten zufolge sind vier von zehn Gemälden, fünf von zehn Grafiken auf dem Markt nach- oder neu gemacht. Zum zweiten bietet sich Kunst geradezu an, gestohlen zu werden: Das begann bei weitem nicht erst 1911 mit dem legendären Kidnapping von Leonardos „Mona Lisa“ aus dem Pariser Louvre, und es endete nicht mit dem Raubzug durchs Grüne Gewölbe, bei dem Unbekannte am 25. November vergangenen Jahrs die Gold- und Edelstein-Geschmeide Dresdens dezimierten. Drittens schlagen Vandalen zu: Dazu kann man unfreiwillig werden, wie das Reinigungsfachkräften widerfährt, die immer mal wieder irgendwo auf der Welt Kunstwerke, die nicht leicht als solche zu erkennen sind, aus Gründen der Sauberkeit entsorgen; schlimmer noch, und außerdem vorsätzlich, ziehen fanatische Bilderstürmer und entfesselte Krieger gegen Kostbarkeiten zu Felde, auch ignorante Tyrannen oder schonungslose Attentäter. Von großen Kulturdenkmälern, so von Palmyra, bleiben danach nur Trümmer und Ruinen. Deutlich kleiner, zugegeben, sehen die Wunden aus, die am 3. Oktober ein oder mehrere Täter auf fast siebzig Artefakten der Berliner Museumsinsel hinterließen. Nicht mit Äxten, Hämmern, Messern schlugen sie zu, ‚nur‘ eine Art Öl verspritzten sie auf Skulpturen und Sarkophagen aus Stein und Holz. Wie es scheint, wiegen die Schäden nicht allzu schwer; Restauratoren bemühen sich, die Flecken zu entfernen. Gleichwohl wird seit gut drei Wochen ermittelt, wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Auf zweierlei weist der Begriff hin: darauf, dass die in Museen gesammelten Kulturgüter eine Art Gesellschaftsbesitz sind; und dass ihre Verschandelung oder Zerstörung einen jeden ärmer macht, nicht viel anders, als zerträte einer ein lieb- und wertgeschätztes Erbstück. Wie hoch oder gering Wert und Schaden sind, bedeutet dabei wenig; es geht ums Prinzip, denn wer Zeugnisse der Geschichte ruiniert, beraubt das kollektive Gedächtnis um Unwiederbringliches. Von den Kuratoren wird schon seit Langem und nun erst recht verlangt, die Exponate ihrer Häuser sorgsamer zu schützen. Gewiss lässt sich da, gerade auch in den weltberühmten Schatzhäusern der Bundeshauptstadt, einiges verbessern. Mit Gewissheit vermeidbar indes sind Gewalt- und Wahnsinnsakte nie. Dem Einbrecher als solchem ist letztlich nichts zu schwer – buchstäblich nicht: Das bewies die ausgebuffte Bande, die im März 2017 bei einer Nacht- und Nebelaktion im Berliner Bode-Museum die kanadische Schaumünze Big Maple Leaf, das „Große Ahornblatt“, an sich brachte und mit einer Sackkarre ins Nirgendwo verschleppte. Über einen halben Meter maß die detailliert gearbeitete – und wahrscheinlich längst eingeschmolzene – Scheibe im Durchmesser, bestand aus purem Gold und wog deswegen hundert Kilogramm, was sie etwa fünf Millionen Euro wert sein ließ. Weitaus schwerer wird es Dieben edler Kunst und edler Metalle werden, die es vielleicht einmal auf eine 2012 in der australischen Prägestätte Pirth Mint hergestellte, achtzig Zentimeter große Münze aus zwölf Zentimeter dickem Gold abgesehen haben könnten: Zwar bekommen sie es mit einem Materialwert von dreißig Millionen Euro zu tun, aber auch mit einer Last von einer Tonne. ■
Wir im Netz
Samstag, 24. Oktober Mitunter begreifen wir Erwachsenen auch Kompliziertes, sofern man es uns nur wie einem Kind erklärt. Zum Beispiel, was das eigentlich ist: das Internet. Es ist „ein großes Netz von Computern auf der ganzen Welt. Etwa vier und eine halbe Milliarde Menschen nutzen es. Das Internet ist um das Jahr 1970 entstanden. Damals gab es nur wenige Computer. Sie waren sehr teuer und sollten nicht unbenutzt bleiben. Darum hat man sie über das Telefonnetz verbunden …“ So lesen wir im Online-„Klexikon“, einer Art Wikipedia für kleine Leute, und fühlen uns auch als Große gar nicht so schlecht unterrichtet dabei. Behörden freilich lieben es, uns Erklärungen in ganz anderer Tonart um die gespitzten Ohren zu schlagen. Heute vor 25 Jahren definierte der Federal Networking Council der Vereinigten Staaten den Begriff und die Sache erstmals offiziell, und zwar so: Das Internet sei das „globale Informationssystem, das (erstens) durch einen weltweit eindeutigen Adressraum auf der Grundlage des Internetprotokolls (IP) oder seiner nachfolgenden Erweiterungen/Folgen logisch miteinander verbunden ist; (zweitens) in der Lage ist, die Kommunikation unter Verwendung der TCP/IP-Suite (TCP/ IP) oder seiner nachfolgenden Erweiterungen/Folgen und/oder anderer IP-kompatibler Protokolle zu unterstützen; und (drittens) entweder öffentlich oder privat hochrangige Dienste, die auf der hier beschriebenen Kommunikations- und zugehörigen Infrastruktur basieren, bereitstellt, nutzt oder zugänglich macht“. Da staunen wir, dass etwas, von dem so verklausuliert gesprochen werden muss, für jeden und jede täglich auf schnurgeradem Weg erreichbar ist. Auch ohne IT-Know-how dürfen wir das Internet großartig finden: Unserer Epoche der Informationen, ihrer Verarbeitung und Verbreitung bescherte es einen Paradigmenwechsel, wie es allenfalls der Buchdruck vor sechshundert Jahren vermochte. Wie alles hat es Vor- und Nachteile: Anonym und schnell, obendrein vielfach gratis gelangen wir an aktuelle Nachrichten aus aller Herren Ländern und können mit entferntesten Mitmenschen ohne Zeitverzug kommunizieren; nur müssen wir uns dabei, wie im analogen Leben auch, vor digitalen Einbrechern (Hackern) und vor üblen Keimen (Viren) schützen, haben die seriösen Quellen aus einer Vielzahl zweifelhafter herauszusortieren und sollten bereit sein, mal mehr, mal weniger intime Details über unser Leben preiszugeben. Sowohl Sammel- als auch Fanggerät ist das world wibe web, so wie jedes Netz. Das ist eine sehr alte Erfindung der Menschheit und für sie seit jeher so wichtig, dass es unter unseren Vorvorfahren schon vor etwa zwölftausend Jahren aufkam. Seinem Gebrauch liegt ein klares Täter-Opfer-Verhältnis zugrunde: Der Fischer, der mit seiner Hilfe Beute macht, freut sich, weil es ihn und die Seinen ernährt; für sein Lebensmittel, den Fisch, bedeutet es das Gegenteil, den Tod. Ähnlich verhält es sich mit den sozialen Netzwerken: Manche Nutzer fischen damit Namen und Daten ab, um Schaden anzurichten; andere erfahren in einer noch nie dagewesenen globalen Gemeinschaft eine neue Form von Aufgeschlossen- und Geborgenheit. Wollen die „sozialen Netze“ ihren Namen verdienen, sollten wir in ihnen nicht gefangen, sondern aufgefangen sein. ■
Tanz mit der Welt
Donnerstag, 22. Oktober Zehn Jahre war der kleine Mario aus Finsterwalde alt, als er von seiner Mutter erstaunt den Vorschlag vernahm, er solle sich um Aufnahme in einer renommierten Tanzhochschule bemühen. Dabei hatte Mario keine Ahnung davon, was man beim Ballett so macht. Doch Mama half ihm auf die Sprünge: „So was Ähnliches wie Charlie Chaplin.“ Dem hatte Mario oft zugeschaut, den fand er klasse. Längst ist aus dem kleinen Mario ein Herr Schröder geworden und aus dem Eleven der Chefchoreograf der Leipziger Oper. Wahrscheinlich ist er als Tänzer dem 1889 gebürtigen Briten Charles Spencer Chaplin, dem wohl populärsten Komiker des US-Kinos, überlegen. Indes erweist eine ikonisch gewordene Filmsequenz, wie subtil und zugleich spöttisch auch der Kinoregisseur und -produzent, -autor und –komponist sich zu bewegen verstand: Da sieht man Chaplin als Anton Hynkel und eigentlich als Adolf Hitler, jedenfalls als „Großen Diktator“, wie er zu Wagnermusik mit einem großen Globus walzt, springt und schwingt, pendelt und zirkuliert, mit einem bemalten Luftballon, der ihm schließlich, im Moment höchster Verzückung, zwischen den Händen zerplatzt. Das hätte Mario Schröder, als Profi, wohl kaum närrischer hinbekommen. Die Ähnlichkeit der Figur Hynkel und des Schauspielers Chaplin mit dem wirklichen Tyrannen und Weltenbrandstifter ist so witzig wie verwirrend, was nicht nur, aber nicht zuletzt an beider Zahnbürstenbärtchen über der Oberlippe liegt. Das Prioritätsrecht daran reklamierte der Spaßmacher für sich: In Zeitungsannoncen beharrte er darauf, der fast auf den Tag gleichaltrige „Führer“ des „Dritten Reichs“ habe ihm den Schnauzer abgeschaut. Dass es sich beim ersten Tonfilm des Künstlers um keine Posse handle, begriffen die Kritiker sofort, die dieser Tage vor achtzig Jahren der Uraufführung beiwohnten. In der New York Times stand tags darauf zu lesen, man habe es mit einem „von Grund auf tragischen – oder im klassischen Sinn tragikomischen – Werk“ zu tun. Ein Welterfolg, für den sein Schöpfer sich später genierte: 1964 beteuerte Chaplin in der „Geschichte meines Lebens“, er hätte die Finger von dem Stoff gelassen, hätte er während der Produktion schon von den Gräueln in den deutschen Konzentrationslagern gewusst. Gleichwohl bestand zur Scham kein Anlass: Als kraftvolle Stellungnahme gegen Totalitarismus und Cäsarenwahn überzeugt der Film bis heute. Auch dass Chaplin mit der Hitler-Persiflage, wie überhaupt mit seinem Schaffen, prima verdient hat, beschädigt sein Andenken nicht. Als er 1977 starb, soll er über ein Vermögen von 415 Millionen Dollar – nach heutigem Wert – verfügt haben. Hierbei war ihm der angeblich „Größte Feldherr aller Zeiten“ allerdings voraus: Hitler habe, heißt es in manchen Quellen, unter Umgehung der deutschen Steuer auf Schweizer Banken den Wert von viereinhalb Milliarden Euro gehortet; allein für seinen Berghof in den Alpen soll er ein Milliärdchen aufgewendet haben. Die Gage eines Leipziger Ballettdirektors erlaubt dergleichen nicht. ■
Wie im Kino
Dienstag, 20. Oktober. Vor 25 Jahren schon war im Kinosaal zu sehen, was im Kinosaal passieren kann, wenn ein spreader hustet. Ziemlich am Anfang des Seuchenthrillers „Outbreak“ besucht in einer US-Kleinstadt ein fiebernder Mann ein Filmtheater, in dem sich Flüssigkeitströpfchen aus seinen Lungen, tricktechnisch überdeutlich zu sehen, im ganzen Saal verbreiten; wenig später nimmt eine Seuche ihren Lauf durchs Kaff, grässlich und tödlich wie Ebola. Was Wolfgang Petersen 1995 als weit hergeholte Dystopie vorzuführen schien, kennen und erleiden zurzeit Kinobetreiber und Festspiele, auch die heute beginnenden Internationalen Hofer Filmtage als existenzbedrohende Wirklichkeit. Bereits kurz nachdem das Corona-Virus seinen pandemischen Zug um die Welt begonnen hatte, konstatierte ein junger Medienwissenschaftler verwundert, wie „überrumpelt“ die Welt darauf reagiere: Nicht grundlos fragt Denis Newiak in seinem Buch „Alles schon mal dagewesen“ danach, „was wir aus Pandemie-Filmen für die Corona-Krise lernen können“. Hatten nicht schon vor Jahren, gar Jahrzehnten Steven Soderbergh in „Contagion“ oder Marc Forster in „World War Z“ einschlägige Szenarien mit Viren durchgespielt? Oder Steven Spielbergs „Jurassic Park“ oder „Independence Day“ von Roland Emmerich: War die Vorstellung einer Bedrohung durch feindliche Lebensformen dort weniger realistisch, nur weil statt unsichtbarer Keime fressgierige Dinosaurier und eroberungswütige Aliens weithin sichtbar die Menschheit auszulöschen trachteten? Denis Newiak war sich von jeher sicher, „dass das Thema irgendwann präsent und relevant wird“, und „fand an der Krise am erschreckendsten, wie überrascht alle waren, vor allem die Politik, etwa in den USA". Dabei kann der angehende Wissenschaftler auf erfahrene Experten verweisen, die „schon lange davor warnen“. Nun aber liegt das Kind im Brunnen, und die Betreiber von Lichtspielhäusern und Festivals müssen sehen, wie sie klarkommen. Nur knapp entging die Berlinale dem Unheil. Als das bedeutendste deutsche Filmfest am 1. März endete, resümierte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek: „Ich denke, dass wir ein Riesenglück hatten.“ Auf dasselbe hofft Hof, das home of films, für die folgenden Tage. Immerhin wissen sich Thorsten Schaumann und sein Team angesichts der zweiten Krankheitswelle vorbereitet: Ihr „duales Modell“ führt die Beiträge an Ort und Stelle vor, in vorschriftsmäßig ausgerüsteten Sälen des Central- und des Scala-Kinos, zudem in der Bürgergesellschaft und im Festsaal der Freiheitshalle; zugleich gibts alle Filme auch on demand im Internet. Wem dabei das geliebte Live-Flair samt Gedränge, Plauderei und Bratwurstbude abgeht, darf sich damit trösten, dass Novitäten auf dem Laptop-Bildschirm immer noch besser sind als gar kein Festival. Brandaktuell übrigens empfiehlt „HoF“ auf seiner Website das „erst- und hoffentlich einmalige" Corona Short Film Festival: Das versammelt kurze Arbeiten,
die von Regisseurinnen und Regisseuren während ihrer Covid-19-Isolation produziert wurden. Zugänglich sind sie, versteht sich, komplett online, als wärs in Quarantäne: in der Klausur des stillen Kämmerleins. ■
Unvorstellbar
Samstag, 17. Oktober. Lang ists her, dass unsere Durchschnittsbildung darauf hoffen durfte, einigermaßen zu durchschauen, für welch imposante Leistungen die naturwissenschaftlichen Nobelpreise verliehen werden. Mittlerweile drangen die Gelehrten so tief in die Fein- und Tiefenstrukturen von Organismus, Materie und Weltall vor, dass sie Einzelheiten ihrer Arbeit der breiten Bevölkerung nicht mehr begreiflich machen können. So geben etwa Koryphäen aus der theoretischen und der Quantenphysik gern zu, selbst sie vemöchten, was sie mathematisch errechneten, sich mit Sinnen und Verstand nicht vorzustellen. Jahrhundertelang hat neuzeitliche Wissenschaft die Welt entzaubert, indem sie unseren Vorvätern und -müttern zahllose Rätsel aufschloss, die auf ewig für unlösbar galten. Wir, heute, stehen kopfschüttelnd vor Entdeckungen, von denen uns die meisten bestenfalls dann zu berühren vermögen, wenn wir uns einfach fraglos auf sie einlassen. Welcher Normalbürger sieht sich ehrlich in der Lage, präzis nachzuvollziehen, auf welche Weise Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, denen kürzlich der Nobelpreis für Chemie zugesprochen wurde, die Crispr-Cas-Genschere an der DNS ansetzen, um ins Erbgut einzuschneiden? Die Kunde, dass jene Option zur Realität gehört, muss reichen, uns Bewunderung abzugewinnen oder uns das Fürchten zu lehren. Im Makrokosmos ergeht es uns nicht anders. Als an Heiligabend 1968 die US-Astronauten der Apollo-8 aus der Mondumlaufbahn das erste im All aufgenommene Farbfoto unseres blauen Planeten ‚hinunter‘-schickten, schufen sie eine überwältigend fassliche Ikone unseres kosmischen Zuhauses – eine fast greifbare Kugel von schwebend-umschleierter Schönheit vor unendlicher Schwärze. Umso unnahbarer hingegen, schier ins Unendliche entrückt, bildete 1990 die Raumsonde Voyager 1 die Erde ab, als pale blue dot, als „blassblauen Punkt“ von Sandkorngröße, aufgenommen aus sechs Milliarden Kilometern Entfernung; eine Distanz, die unsere Imaginationskraft buchstäblich um Längen übersteigt. Erst recht tun dies die 55 Millionen Lichtjahre (also 55 mal 9,46 Billionen Kilometer), die das erste fotografierte Schwarze Loch von uns trennt; im April vergangenen Jahres machte die Aufnahme Furore. Es hat die Masse von 6,6 Milliarden Sonnen – wer ahnt nur leise, welch ungeheuren Gravitationskräfte in ihm wirken. Und erst dieser Tage sorgten Berichte über ein „kosmisches Spinnennetz“, dreihundert Mal größer als unsere Milchstraße, für Aufsehen. In seiner Mitte hält wiederum ein Schwarzes Loch Fäden von außerordentlich verdichteten Gasen fest; dort, wo sie sich kreuzen, bindet das Gewebe mindestens sechs, vermutlich weit mehr Galaxien an sich. Was die Astronomen davon beobachten, vermittelt ihnen den Zustand von vor etwa dreizehn Milliarden Jahren – so lange brauchte das Licht von dort zu uns. Wie wollten unsere Gehirne solche Dimensionen erfassen, wenn ihnen schon die kosmischen Ereignisse in ihrer Ungeheuerlichkeit nicht klar werden, die ihnen zugrunde liegen? Vielleicht sollten wir es wieder mehr mit dem Erz-Philosophen Immanuel Kant halten: Mag sein, dass wir dem „moralischen Gesetz“ in uns nicht mehr ganz so blind wie er vertrauen dürfen; doch sein Staunen über den „gestirnten Himmel“ über uns, das empfiehlt uns die Astronomie in jedem Jahr aufs Neue. ■
Hand-Schuh
Dienstag, 13. Oktober. Politiker müssen fest auf dem Boden der Tatsachen stehen, wofür sie, ebenso wie robuste Schenkel, auch Füße von ausdauernder Stabilität brauchen. Weil Letztere zu den besonders empfindlichen Stellen des Körpers zählen, tun Stadtväter und -mütter wie Staatsmänner und Regierungschefinnen gut daran, sich mit strapazierfähigem Schuhwerk zu versorgen. Bequem darfs gleichwohl sein, wie Joschka Fischer es unvergesslich vorexerzierte: Als der spätere Bundesaußenminister 1985 erst mal das hessische Umweltressort übernahm, legte er den Amtseid im Landtag zu Wiesbaden in High-Top-Sneakern von Nike ab, in weißen, versteht sich, damit die Turnschuhe auf den damals noch meist grauen Pressefotos auch zuverlässig zur Geltung kämen. Ein „Symbol der Grünen als Lifestyle-Partei junger, cooler, urbaner Menschen“ sah dieser Tage die Neue Zürcher Zeitung erinnernd in Fischers damaliger Trendkluft – was Gedanken an andere Fußbekleidung, die Geschichte schrieb, nahelegt. So machte heute vor sechzig Jahren Nikita Chruschtschow, seinerzeit Staatschef der Sowjetunion, bei der fünfzehnten Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York nicht allein als Redner von sich reden, sondern mehr noch, weil er während einer Schimpftirade zornentbrannt den rechten Schuh vom Fuß riss. Bis hierher darf die ostwestkonfliktgeladene Episode historisch als einigermaßen verbürgt gelten; immerhin zeigt das einzige Foto des Vorfalls den Schuh auf Chruschtschows Tisch liegen. Darüber aber, was danach geschah, gehen die Aussagen auseinander. Augenzeugen gaben an, der Politiker habe mit dem Schuh in der Hand von seinem Platz aus in Richtung eines Abgesandten gestikuliert, der ihn in Rage gebracht hatte. Die New York Times hingegen notierte: „Er stand auf und schwang den Schuh drohend in Richtung der philippinischen Delegation. Anschließend hämmerte er mit seinem Schuh auf den Tisch.“ Wie dem wirklich war, spielt kaum mehr eine Rolle: So und nicht anders brannte sich die Szene mit unauslöschlicher Eindeutigkeit ins kollektive Gedächtnis eint, denn weithin galt der KPdSU-Chef und Ministerratsvorsitzende aus Moskau als unbeherrschter Rüpel. Auch anderweitig fallen einschlägige Lederwaren bis in die hohe Politik hinein ins Gewicht. Vor allem in islamischen Ländern drücken Politiker ihren Unwillen aus, indem sie mit Schuhen vor ihren Gegnern herumhantieren oder den Widersacher gar damit bewerfen. Am spektakulärsten geschah dies am 14. Dezember 2008 in Washington, als ein Journalist aus dem Irak zwei Treter nach Präsident George W. Bush schleuderte. Ähnliches widerfuhr, zum Beispiel, 2011 dem früheren ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak – und im Jahr darauf seitens wutschnaubender Demonstranten Christian Wulff, obwohl der als deutscher Bundespräsident doch eher eine aggressionshemmende Bravheit ausstrahlte. Derzeit regiert in den USA ein Rabauke an der Grenze zum Kontrollverlust, hierin seinem Sowjetkollegen aus den Fünfzigern und Sechzigern vergleichbar. Ungehemmt feuert er mit Galle, Gift und fake news rund um sich. Ein Handy flog ihm schon einmal entgegen, Schuhe bislang nicht. ■
Feurio!
Samstag, 10. Oktober. Es brennt. „Feurio“ heißt ein beliebtes Programm, das jenen von uns, die sich noch nicht von den Streaming-Diensten haben übermannen lassen, erlaubt, Audio-CDs am heimischen Computer zu brennen. „Feurio!“ riefen einst die Wächter von den Türmen einer Stadt, wenn sie unsere Altvorderen vor einem Brand warnen wollten, den sie im Gedränge der meist schmalen Straßen und meist hölzernen Häuser entdeckt hatten. Zwischen Dienstag und Mittwoch – dies nur als Beispiel – hätten sie in Blaufelden (Kreis Schwäbisch-Hall) und in Güglingen (Kreis Heilbronn) solcherart rufen müssen, desgleichen in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) und in Auhagen (Landkreis Schaumburg), in Chemnitz und Berlin … Die Medien beobachtend, könnte man meinen, unser Land brenne an allen Ecken und Enden. Unser Planet brennt. Nicht nur, dass er, der Erderwärmung wegen, auf kleiner Flamme vor sich hin kokelt: Als der heißeste September seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen geht der soeben vergangene in die immer traurigere Geschichte des Weltklimas ein. Jüngst zogen in den Vereinigten Staaten ein amtierender Präsident und ein Anwärter aufs Amt mit heißen Köpfen, glühendem Hass und feuriger Rhetorik wie mit Flammenwerfern gegeneinander los. Offen schlagen Flammen – um vom Regenwald des Amazonas gar nicht erst zu reden – aus den Wäldern Griechenlands und Kaliforniens, erst recht aus den Konfliktgebieten im Jemen, in Afghanistan und Syrien, im Südsudan, um nur ein paar zu nennen. „Es brennt“ sogar in der Kunsthalle des eher wohltemperierten Nürnberg: Unter dem brenzligen Titel zeigt Marcel Odenbach bis zum 10. Januar Bildkunst über eine Welt, in der es uns ganz schön heiß werden kann. Kopierend und collagierend fertigte der 67-jährige gebürtige Kölner Arbeiten aus Hunderten kleiner Einzelbilder, die der – Corona-gemäß distanzierte – Betrachter wie Mosaiken als einheitliche und doch gebrochene, beunruhigende Ganzheiten wahrnimmt. Auf ihre Art veranschaulichen sie Autoritarismus, Rassismus und Kolonialismus, Ideologien und Ungerechtigkeiten – Themen, die uns allen täglich auf den Nägeln brennen sollten. Zum Optimismus verführt die Schau uns nicht. In der Geschichte der Kunst, fast von ihren Anfängen an, tritt uns Feuer oft, allerdings nicht immer verheerend bis zum Weltenbrand entgegen, sondern auch heimeliger als Wärmespender in kalter Wüstennacht, erleuchtend oder heilig gar als Feuerzunge des Geistes, überhaupt als Urfunke der Kultur, wenn Prometheus den Menschen das Feuer bringt – oder, als göttlicher Dornbusch, der, von Mose ehrfürchtig bestaunt, brennt, ohne zu verbrennen. In unserer Alltagswirklichkeit macht Feuer uns leicht bang, kann doch schon eine kleine Kerzenflamme binnen Sekunden außer Kontrolle geraten. So wie wir Menschen selbst, wenn wir erst mal Feuer fangen, ob aus Liebe oder Zorn. Die Wut im Bauch, zumal im weiblichen, verzehrt und verheert wie eine Feuersbrunst. Dann möchte ‚man‘ am liebsten „Feurio!“ rufen, denn nicht umsonst klingt der feuerwehrmännliche Warnruf an „Furie“ an. ■
Nicht genug Leben
Donnerstag, 8. Oktober. Mommsen und Heyse, Hauptmann und Mann (Thomas), Hesse und Böll, Canetti und Grass, Nelly Sachs, Jelinek und Herta Müller, zuletzt Peter Handke ... – die Liste der deutschsprachigen Dichterinnen und Dichter, die zwischen 1902 und 2019 mit dem Nobelpreis geehrt wurden, sieht so kurz nicht aus und wiegt ziemlich schwer. Vor fünfzig Jahren durfte sich in die Reihe der größten Autorinnen und Autoren einer einreihen, der zwar Russe war, aber Deutschland als existenzielle Durchgangsstation erlebte: Am 8. Oktober 1970 erfuhr die literarische Welt, dass Alexander Solschenizyn die Ehre widerfahren würde. Kam sie ihm gelegen? Jedenfalls vermied ers, zur Verleihung am 10. Dezember nach Stockholm zu reisen, konnte er doch nicht fest damit rechnen, wieder in die UdSSR eingelassen zu werden. Denn der Schriftsteller, wiewohl einer der meistbeachteten seiner Zeit, war daheim nicht eben wohl gelitten. Als Kritiker Josef Stalins hatte er von 1945 bis 1956 Lagerhaft und Deportation erduldet, wovon sein literarisches Debüt von 1962, der Roman „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, beklemmend Auskunft gibt. Weit detaillierter dokumentierte Solschenizyn das brutale sowjetische Straflager- und Verbannungssystem im „Archipel GULAG“, dessen drei dicke Bände zwischen 1973 und 1976 erschienen. Von der Niedertracht der Täter berichten sie und von der oft beeindruckenden inneren Größe vieler Opfer, denen „nicht genug Leben" vergönnt war, um selbst von all dem zu erzählen. Dass der Dissident längst eine internationale Berühmtheit war, kümmerte Moskau wenig: 1974 setzten die Behörden Solschenizyn neuerlich fest, um ihn sodann in die Bundesrepublik abzuschieben. Dort fand er (wie sechs Jahre nach ihm Lew Kopelew) ein erstes Asyl im Haus Heinrich Bölls, des Preisträgers von 1972. Später lebte Solschenizyn in den USA, bevor er 1994 in ein anderes Russland zurückkehrte. Hier nahm er zwischen den Stühlen Platz: Denn sowohl seiner Heimat wie dem Westen warf er den Niedergang ihrer Wertvorstellungen vor. Indes hinderte ihn das nicht, mit Wladimir Putin zu sympathisieren und von ihm 2007, ein Jahr, bevor er 89-jährig starb, den Staatspreis der Russischen Föderation entgegenzunehmen. Viele seiner langjährigen Gefolgsleute hatte er da bereits mit den antisemitischen Tönen brüskiert, die er in einem Spätwerk über die Juden in der russischen Geschichte anschlug. Am heutigen Donnerstag nun soll bekannt werden, wer von 197 Nominierten heuer den Preis bekommt. Dass ein deutscher, österreichischer oder Schweizer Name wie Donnerhall durch die Welt brausen wird, gilt als wenig wahrscheinlich. Experten meinen gar, ganz Europa habe diesmal keine Chance. ■
Licht im Dunkeln
Montag, 5 Oktober. Die Blinden sehen unterschiedlich. Die mit Sehrest erkennen noch einigermaßen Konturen, Helligkeit und Farben. Jene, die buchstäblich ohne Augenlicht zur Welt kamen, gewahren buchstäblich nichts, auch nicht Schwarz. Denn weil sie niemals Farben, Hell und Dunkel zu unterscheiden lernten, bildete ihre Wahrnehmung, anders als die der Sehenden, Kategorien dafür von vornherein nicht aus. Freilich wird niemand, der bei Verstand ist, einem blinden oder sehbehinderten Menschen das Licht im Innern absprechen, und ebenso wenig das Verlangen, sich erleuchten zu lassen, sein Licht auf den Scheffel statt darunter zu stellen und sich und seine Welt ins rechte Licht zu rücken. Letzteres tun Gerald Pirner und drei weitere „Blinde Fotograf*innen“ in einer Ausstellung in Berlin, die seit Samstag (und bis zum 17. Januar) im „Freiraum für Fotografie“ in der Waldemarstraße 17 zu besichtigen ist. Pirner liebte, bevor er sein Augenlicht verlor, Kino und Malerei, wie er in Interviews berichtete. Seine Porträts entstehen durch extrem lange Belichtung in Räumen, schwarz wie die Nacht, in denen er mittels Taschenlampen immer nur ein wenig Licht ins Dunkel bringt, als ob er mit dem künstlichen Schein „malte“; lightpainting heißt die Technik denn auch. Mit wachsendem Nachdruck beharren Blinde darauf, voll in die helle, kolorierte Welt integriert zu werden. Längst zum Fernsehalltag gehört die „Audiodeskription“, die zwischen den Dialogen in knappen Worten beschreibt, was der Bildschirm gerade zeigt. Ähnliche Unterstützung, wenn nicht gar spezielle Aufführungsvarianten bieten etliche Theater an. Übrigens präsentierte das Jugendensemble des Theaters Hof schon vor zwölf Jahren eine Produktion, die vom Sehen handelte, indem sie vom Gegenteil erzählte: von blinden Studenten, die das Stigma tragen, anders als andere zu sein, und doch auf Normalität bestehen. Blinde sind keine Schwarzseher: Die meisten von ihnen, so betont der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin auf seiner Website, dürfen als Optimisten gelten. Sie sichten, beim Blick in die Zukunft, Licht am Ende des Tunnels. ■
Rechts oben
Donnerstag, 1. Oktober, 00.01 Uhr. Rechts oben – da sind wir. Beim Blick auf eine Landkarte, die Bayern zeigt, am besten mitsamt den angrenzenden Gebieten, findet sich Hochfranken eben dort, im Nordosten, und hat das sächsische Vogtland und die nördliche Oberpfalz erfreulich nah bei sich. Bis 1989 machte die Republik hier einen Punkt: Nichts ging mehr. Zumindest gings nicht weiter Richtung Osten. Seither aber hat sich unsere Ecke in Sachen Kultur gehörig gemausert. Eine damit derart reich gesegnete ländliche Region findet sich irgendwo im Lande nicht so leicht noch einmal. Zum Eckpunkt ist Hochfranken geworden, und deshalb heißt auch diese Kolumne so, die auf unserer Website zwei bis drei Mal wöchentlich erscheinen soll. Darum auch schaut das dazugehörige Signet – das dem Hochfranken-Feuilleton (ho-f) überhaupt als Markenzeichen dient – so aus: Eine Art Punkt stellt es dar, gebildet aus konzentrischen Kreisen, die unvollständig bleiben, weil sie sich rechts oben (wo sonst?) im Winkel einer Ecke treffen. Ein sinniges Symbol für den Stellenwert, den Künstlerinnen und Künstler, Kreative, Intellektuelle und Veranstaltende am Ort beanspruchen dürfen. Mit ‚Provinz‘ hat jener Ort nichts zu tun; die hat ihren Platz zwischen den Ohren, findet mithin in Köpfen statt, was in Hamburg wie in Hof, in Berlin wie in Bad Steben, in München wie in Münchberg gelegentlich passiert. Auf der Landkarte heißen Gegenden wie die unsere Peripherie, was nicht mehr besagt, als dass wir abseits von den Metropolen, in Außenbezirken neben den Ballungsräumen gelernt haben, ganz gut zu leben und zu schaffen und schöpferisch zu sein. Auf das Kulturleben in und um die Städte Hof und Wunsiedel mit ihren Landkreisen, zwischen Naila und Waldsassen, Bayreuth und Plauen will ho-f fortan ernst nehmend, wenn auch nicht bierernst den kritisch interessierten Blick richten. Denn selbst in Krisen- und Seuchenzeiten wie augenblicklich im Coronozän wollen Kreativität und Inspiration in Nordostbayern und dem angrenzenden Südsachsen einfach keine Ruhe geben. Wirklich, wir stecken mittendrin, so rechts oben, im Zentrum der Republik. Irgendwo ist andernorts. ■