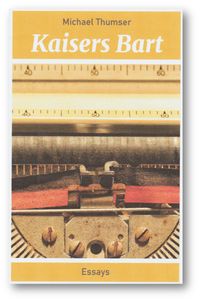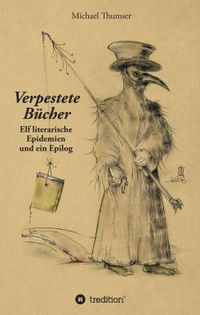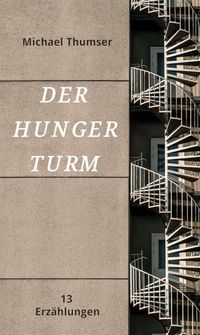Heiligabend, Hof, Theater, Studio
Seit das Stück 2003 uraufgeführt wurde, ist Verbrennungen auf internationalen und auch vielen deutschen Bühnen präsent. Der im Libanon geborene Frankokanadier Wajdi Mouawad erzählt darin vom Leid einer im Bürgerkrieg traumatisierten Mutter und von ihren Kindern, die einem grausamen Familiengeheimnis auf die Spur kommen. Mit der souveränen Anja Stange in der Hauptrolle wirkt Petra Schönwalds endringliche Inszenierung im Betrachter lange nach.
19. Dezember 2025 Eine Berliner Legende behauptet, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sei Hungrigen eine Currywurst teurer zu stehen gekommen als eine Portion Kaviar. Stimmt das? Leider schloss das einschlägige Bildungsinstitut in der Metropole, das Currywurst-Museum, 2018 seine Tore. Aber vielleicht lässt sich der Wahrheitsgehalt der steilen These ja im Haus der Geschichte in Bonn nachprüfen? Geschlossen war dies Museum zwar auch, aber nur für vierzehn Monate; und nur, um sich, wie ein bundesrepublikanisches Leitmedium vermeldete, als „Dauerausstellung zum Mitmachen und Anfassen ein Stück weit neu zu erfinden“. Etwas weniger floskelhaft lässt sich mitteilen, dass die Präsentation seit der Wiedereröffnung Anfang des Monats auf 4500 Quadratmetern 3850 Exponate zeigt, die ein ungefähres Gleichgewicht herstellen zwischen der Zeit von 1945 bis 1989 und den gut dreieinhalb Jahrzehnten seit Mauerfall und Wende. Die Statistik gibt dem Leiter Harald Biermann und den etwa zweihundert Mitarbeitenden, mit denen er die Schau frisch konzipierte, recht: meldeten doch die etwa 7100 Museen im Lande – zusammen mit den ungefähr 530 Ausstellungshäusern, die keine eigene Sammlung vorhalten – im vergangenen Jahr 107,4 Millionen Besuche und damit 1,3 Prozent mehr als 2023. Das sind neun bis zehn Mal so viele wie bei allen Fußballspielen insgesamt, von der ersten Bundesliga bis zur Amateur-Kickerei. Interesse ist mithin wahrlich vorhanden – und war es schon, seit die Fürsten der Renaissance in sogenannten Wunderkammern zusammentrugen, was ihnen einzigartig kurios und/oder sündhaft kostbar erschien. So zeigt das Dresdner Grüne Gewölbe, ursprünglich Schatzkammer Augusts des Starken, den unbezahlbaren „Grünen Diamanten“, aber ebenso einen nicht minder unvergleichlichen Kirschkern mit 185 geschnitzten Köpfen, wenn auch deutlich geringerem Materialwert. Wer durch das größte Museum der Welt flaniert, den Louvre in Paris, mag sich eingeschüchtert fühlen von den Massen erhabener Artefakte und Kunstwerke aus aller Herren Ländern und allen Epochen der Geschichte. Auch ein Besuch der Berliner Museumsinsel, die allein fünf erstklassige Institute von Weltrang beherbergt, lässt einen staunend erstarren. Dabei liegt eitle Protzerei gar nicht in der Absicht seriöser Häuser, und schon gar nicht erliegt man im Bonner Haus jener Versuchung. Grundsätzlich geht es Museen um Breitenbildung, um die sichere Aufbewahrung kulturellen Erbes und seine Erforschung, sie wollen Aufmerksamkeit wecken für das Weiterwirken des Vergangenen, den Interessens- und Wissensaustausch innerhalb der Gesellschaft anregen und nicht zuletzt den Tourismus fördern. Alles ehrenwerte Ziele; denen das Haus der Geschichte entschieden, weil ganz und gar nicht abschreckend, sondern betont vereinnahmend zustrebt. „Du bist Teil der Geschichte“, versichert seine neue Parole kumpelhaft jedem Einzelnen, der es betritt. Zu den Schaustücken aus dem west-, ost- und gesamtdeutschen Alltag zählt ein Ortsschild, das flippig bunt daran erinnert, wie sich Gelsenkirchen im Juli 2024 zeitweilig in „Swiftkirchen“ umbenannte. Das war reichlich albern, zugegeben, aber es belegt, dass nicht Polit- und Geistesgrößen allein Akteure ihrer Zeit sind, sondern Popstars genauso. Und also jeder und jede der etwa 180.000 Menschen, die zu Taylor Swifts drei Konzerten strömten, irgendwie auch. ■
Alle bisherigen Kolumnen in den
Eckpunkt-Archiven (siehe oben im Menü)
Rückblick
23. Dezember, Hof, Theater, Großes Haus
Indische Tempeltänze auf einer deutschen Bühne? Das schaut heutzutage leicht nach oberflächlicher kultureller Aneignung aus. Trotzdem hat sich Regisseur Oliver Pauli an Emmerich Kálmáns selten gespielte Operette Die Bajadere aus dem Jahr 1921 gewagt - und das dünne Eis wohlweislich umgangen. In der Titelrolle der sinnfrei unterhaltsamen Produktion ist ausdrucksstark Annina Olivia Battaglia zu erleben, die nicht nur prima singt, sondern sich auch so bewegt.
17. Dezember, Kino
2003 berichtete Azar Nafisi in einem Roman, wie sie 1979 aus dem US-Exil in ihre iranische Heimat zurückkehrt, unter der Herrschaft der Mullahs aber nicht als Englisch-Professorin lehren darf. Stattdessen vereint sie sieben Studentinnen im „Glauben an die Literatur“ - und zu einem geheimen Lektürezirkel. In Eran Riklis Verfilmung Lolita lesen in Teheran steht die Schauspielerin Golshifteh Farahani charismatisch für intellektuelle Freiheit und weiblichen Widerstand.
Theater Hof
Schauspiel
zuletzt
Verbrennungen
Die Orestie
Nipplejesus
Das Leben ein Traum
Musiktheater
zuletzt
Die Bajadere
Monty Python’s Not the Messiah
Die Tagebücher von Adam und Eva
Ranzlichter
Theater andernorts
zuletzt
Der große Gatsby in Bayreuth
Prima Facie im Vogtlandtheaster
Die Meistersinger in Bayreuth
Salome im Vogtlandtheater
Konzert
zuletzt
80 Jahre Symphoniker: Ein „Hymnus“, die „Eroica“ und der Bratschist Nils Mönkemeyer
Spätwerk eines früh Verstorbenen: Mozarts Klarinettenkonzert in Selb
Übungen in Nostalgie: Korngold und Rachmaninow reichen sich die Hand
Klassiker der Leinwand: Die Symphoniker spielen für die Sparkasse Hochfranken
Film
zuletzt
Lolita lesen in Teheran
59. Internationale Hofer Filmtage
Mission Impossible - The Final Reckoning
48. Grenzland-Filmtage Selb/Aš
Kleinkunst, Kabarett, Comedy
zuletzt
Erwin Pelzig macht in ernsten Zeiten ernst
TBC macht lauter gute Vorschläge
Olaf Schubert bewertet die Schöpfung
Philipp Scharrenberg verwirrt Bad Steben
Anderes
zuletzt
Die Holländerinnen: Dorothee Elmigers Tropen-Horror ist ein Meisterwerk
Buch & Musik: Biedermanns „Lázár“ ein Flop, Spohrs Kammermusik wunderbar
Der neue McEwan: Mit dem Top-Romancier auf der Suche nach einem verlorenen Gedicht
Musik: Klaviermusik von Bach und Clara Schumann, Hartmanns Violinkonzert
Das neue Buch ist da
SCHWEBENDE VERFAHREN - (2025) Vierzehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 436 Seiten, gebunden 25, als Paperback 18 Euro.
Solange in der Rechtsprechung oder der Verwaltung ein Vorgang „anhängig“ ist, sprechen wir von einem „schwebenden Verfahren“. Noch ist also kein Beschluss, kein Urteil ergangen. Dürfen wir beim Blick in die Vergangenheit von unwandelbar gesicherten Tatsachen sprechen, wenn wir bedenken, dass nichts beständig ist außer dem Wandel? Dass wir etwas für wert erachten, als „historisch“ festgehalten zu werden, wurzelt in unserem momentanen Blick. Nicht nur, aber vor allem auch davon berichten die Texte dieses Buchs. Was wir erleben und an Fakten sammeln, sind Etappen und vielleicht nur Augenblicke eines „schwebenden Verfahrens“: eines Prozesses, den wir Geschichte nennen. Das abschließende Urteil steht aus und wird nicht von uns gesprochen werden.
Im Buchhandel und online weiterhin erhältlich
KAISERS BART - (2022) Dreizehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 344 Seiten, gebunden 25, als Paperback 18, als E-Book 9,99 Euro.
Auch Kaisers Bart kommt vor in diesem Buch, zum Beispiel der des mittelalterlichen Staufers Barbarossa. Wenn wir uns indes heute „um des Kaisers Bart streiten“, dann geraten wir nicht wegen einer royalen Haupt- und Staatsaktion, sondern um einer Bagatelle willen aneinander. Dem Gewicht nach irgendwo dazwischen halten sich die Themen der dreizehn Essays auf, die alle dem weiten Feld der Kulturgeschichte entsprossen sind. Umfassend recherchiert und elegant formuliert, erzählen sie über Bücher und Bärte, Genies und Scheusale, über selbstbestimmte Frauen, wegweisende Männer und Narren in mancherlei Gestalt, über Stern- wie Schmerzensstunden der Wort- und Tonkunst. Worüber berichtet wird, scheint teils schon reichlich lang vergangen – „sooo einen Bart“ hat aber nichts davon.
VERPESTETE BÜCHER - (2021) Elf literarische Epidemien und ein Epilog. Von Michael Thumser. Mit Buchschmuck von Stephan Klenner-Otto. Verlag Tredition, Hamburg, 172 Seiten, gebunden 16,99, als Paperback 8,99, als E-Book 2,99 Euro.
Dieses Buch ist nicht das Buch zur Krise. Freilich ist es ein Buch zur Zeit. Es will einem traditionsreichen, aber noch unbenannten Genre der Weltliteratur einen passenden Namen geben: dem Seuchenbuch. Erstmals erschienen die literaturkundlichen Essays während der Corona-Pandemie auf dieser Website. Vermehrt um ein Kapitel über Mary Shelleys Roman „Der letzte Mensch“, wurden sie sämtlich überarbeitet. Den ausgewählten Werken der deutschsprachigen und internationalen Erzählkunst ist gemeinsam, dass in ihnen Epi- und Pandemien eine Hauptrolle spielen. So belegen die Werkporträts, dass die Furcht vor Seuchen und die Hilflosigkeit gegen deren raumgreifendes Wüten die Geschichte der Menschheit als Konstanten durchziehen. Die Beispielhaftigkeit der vorgestellten Seuchenbücher verleiht ihnen über ihre Epochen hinaus Wirkung und Gewicht.
WIR SIND WIE STUNDEN - (2020) Neunzehn Essays von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 340 Seiten, gebunden 21,99, als Paperback 12,99, als E-Book 2,99 Euro.
Mehr oder weniger handeln alle hier versammelten Texte von Zeit und Geschichte, Fortschritt und Vergänglichkeit, von Werten und Werden, Sein und Bleiben, von Wandel und Vanitas. Zwischen 2010 und 2020 entstanden, wollen sie als Essays gelesen werden, folglich weniger als Beiträge zu den Fachwissenschaften, mit denen sie sich berühren, denn als schriftstellerische Versuche. Formal handelt es sich um sprachschöpferische Arbeiten eines klassischen Feuilletonisten, inhaltlich um Produkte von Zusammenschau, Kompilation und Kombination, wobei der Verfasser Ergebnisse eingehender Recherchen mit eigenen Einsichten und Hypothesen verwob, um Grundsätzliches mitzuteilen und nachvollziehbar darüber nachzudenken.
DER HUNGERTURM - (2011/2020) Dreizehn Erzählungen von Michael Thumser. Verlag Tredition, Hamburg, 288 Seiten, gebunden 19,99, als Paperback 10,99, als E-Book 2,99 Euro.
Von Paaren handeln etliche der dreizehn Geschichten in diesem Band: von solchen, die auseinandergehen, von anderen, die „trotz allem“ beieinanderbleiben, von wieder anderen, die gar nicht erst zusammenfinden. Dass die Liebe auch bitter schmecken kann, ahnen oder erfahren sie. Sich selbst und der Welt abhanden zu kommen, müssen manche der Figuren fürchten, den Kontakt zu verlieren, allein zu sein oder zu bleiben und nichts anfangen zu können, nur mit sich. Manche haben ihren Platz ziemlich weit fort von den anderen, zum Beispiel hoch über ihnen wie der namenlose Protagonist der Titelerzählung "Der Hungerturm". Irgendwann freilich werden sie aufgestört von der halb heimlichen Sehnsucht, mit jemandem zu zweit zu sein. Bei anderen genügt ein unerwarteter Zwischenfall, dass der Boden unter ihren Füßen ins Schwanken gerät und brüchig wird. Und es gibt auch welche, denen die Wirklichkeit in die Quere kommt, weil sie ein Bild von sich und Ziele haben, die nicht recht zu ihnen passen. Knapp und zielstrebig, bisweilen in filmartig geschnittenen Szenen und Dialogen berichten die zeitlosen Erzählungen davon, wie aus Unspektakulärem etwas Liebes- und Lebensbestimmendes, mitunter Tödliches erwächst.